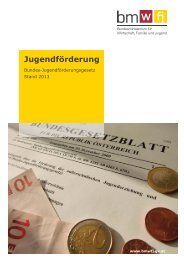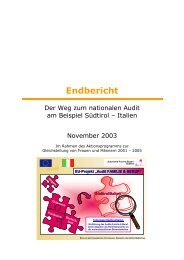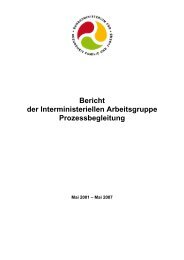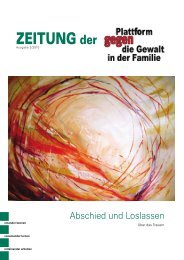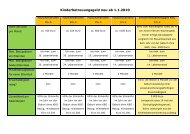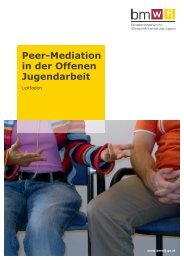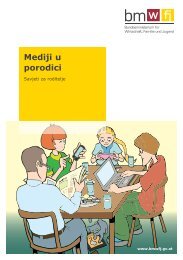Gewaltbericht - Kurzfassung - BMWA
Gewaltbericht - Kurzfassung - BMWA
Gewaltbericht - Kurzfassung - BMWA
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
6. DIE MEDIENBERICHTERSTATTUNG<br />
ÜBER GEWALT<br />
6. 1. Die Rolle der Medien<br />
Wir leben heute in einer Medien-, einer Informationsgesellschaft,<br />
die auch als „global village“ bezeichnet<br />
wird: Die Welt wird zum Dorf, wenn Fernsehen,<br />
Internet und Satellitenkommunikation Nachrichten<br />
aus dem entferntesten Winkel der Erde leicht<br />
zugänglich machen. Wird eine Gesellschaft als<br />
Informationsgesellschaft bezeichnet, so liegt der<br />
Schluss nahe, dass die Strukturen, über die diese<br />
Informationen vermittelt werden – die<br />
Massenmedien also – von großer Bedeutung auch<br />
für soziale Wandlungsprozesse sind. Medien verfügen<br />
über ein gewisses Machtpotenzial, das missbräuchlich<br />
angewendet oder beschnitten werden<br />
kann. Missbrauch geschieht dabei nicht zwingend<br />
durch Zensur oder andere staatliche Eingriffe,<br />
sondern primär durch die selbst auferlegten und sich<br />
selber verstärkenden Regeln und Gesetzmäßigkeiten<br />
der Massenmedien. Damit ist im Bereich der<br />
tagesaktuellen Medien der Zwang zur Aktualität<br />
gemeint – aber auch die vereinfachende Kürze von<br />
Meldungen.<br />
Unter JournalistInnen existiert ein Konsens darüber,<br />
welche Ereignisse zu Nachrichten im Rahmen der<br />
Berichterstattung werden und welche nicht. Diese<br />
Tatsache bewirkt eine große Homogenität bei der<br />
Beurteilung von sozialen Problemen, die zu einer<br />
gewissen Übereinstimmung der publizierten<br />
Meinungen führt. Die in Österreich herrschende<br />
Medienkonzentration verstärkt diesen Effekt noch.<br />
Nachrichten entstehen nicht „von selbst“, sie hängen<br />
von vielen Faktoren ab – von gesellschaftlichen,<br />
politischen und ökonomischen Verhältnissen,<br />
Normen der Produktion von Medien, publizistischen<br />
Erfolgsprinzipien und Selektionskriterien. Gleichzeitig<br />
können die Medien einige dieser Faktoren auch mitbestimmen.<br />
Die Verbindung zwischen oftmals<br />
sexistischen Medieninhalten, frauenfeindlichen<br />
Strukturen in der Medienproduktion und der<br />
patriarchalen Gesellschaft sind weder zufällig noch<br />
leicht zu durchschauen. Fest steht jedenfalls, dass<br />
„Frauenthemen“, die Bedürfnisse und Interessen von<br />
Frauen als „privat“ und „unpolitisch“ betrachtet<br />
werden, „Männerthemen“ jedoch als „neutral“ und<br />
„allgemein gültig“ angenommen werden.<br />
Medien können langfristige Einflüsse auf die<br />
Realitätskonstruktion der RezipientInnen haben.<br />
Über Massenmedien vermittelte Informationen<br />
erlangen vor allem dann eine große Bedeutung,<br />
22<br />
wenn sie über Themen berichten, die sich der<br />
unmittelbaren persönlichen Erfahrung entziehen.<br />
So gaben im Rahmen einer deutschen Studie 1993<br />
96% der Befragten (Eltern) an, ihre ersten<br />
Informationen über sexuelle Gewalt aus Zeitungsberichten<br />
bezogen zu haben, nur 17% hatten zu<br />
diesem Thema bereits ein Buch gelesen.<br />
Medien sind aber auch aufgefordert, politische und<br />
soziale Institutionen und Machtgruppen zu kontrollieren,<br />
die herrschenden gesellschaftlichen<br />
Zustände zu hinterfragen und gegebenenfalls zu<br />
kritisieren. Die mediale Kontrollfunktion erhält<br />
besondere Bedeutung im Zusammenhang mit<br />
Kriminal- und Gerichtsberichterstattung, in der die<br />
Arbeit der Exekutive und Justiz „überwacht“ wird und<br />
eventuelle Missstände aufgezeigt werden können.<br />
Wie sich die mediale Berichterstattung über „Gewalt<br />
in der Familie“ in den vergangenen Jahren darstellt,<br />
war Thema von zwei Untersuchungen, die im<br />
Rahmen des <strong>Gewaltbericht</strong>s beauftragt wurden.<br />
Die erste Erhebung befasst sich mit dem Themenschwerpunkt<br />
„Gewalt gegen Kinder“, die zweite mit<br />
„Gewalt gegen Frauen“. Die Fragestellungen und<br />
Ergebnisse der beiden Studien finden sich im<br />
Anschluss.<br />
6. 2. Gewalt gegen Kinder in den Printmedien<br />
Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der<br />
medialen Darstellung von Kindesmisshandlung<br />
scheint – wie die öffentliche Thematisierung generell<br />
– einige Anlaufschwierigkeiten gehabt zu haben.<br />
Im deutschsprachigen Raum sind nur wenige<br />
Studien zu finden – bei den spärlich vorliegenden<br />
gibt es allerdings einige Übereinstimmungen.<br />
Studien über Kindesmisshandlung aus Deutschland,<br />
Österreich und Großbritannien belegen u.a., dass<br />
die Zahl der Artikel zu sexueller Gewalt in den<br />
letzten Jahren zugenommen hat, Einzelfalldarstellungen<br />
und Tatverläufe dominieren, Ursachen und<br />
Hintergründe werden jedoch kaum thematisiert. Die<br />
Berichterstattung konzentriert sich auf die<br />
TäterInnen, ist mit Stereotypen behaftet und tendiert<br />
dazu, Gewalt als individuelles, nicht als gesellschaftliches<br />
Problem darzustellen.<br />
6. 2. 1. Darstellung innerfamiliärer Gewalt<br />
gegen Kinder und Jugendliche<br />
1989-1999<br />
Ziel der für den Bericht „Gewalt in der Familie“<br />
durchgeführten Studie war es, die Entwicklung der<br />
printmedialen Darstellung von 1989-1999 zu untersuchen.<br />
Insgesamt wurden mehr als 1.500 Fall-