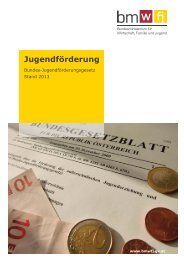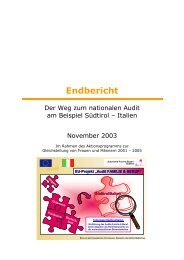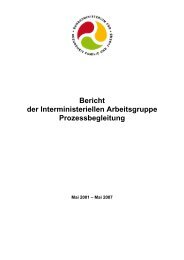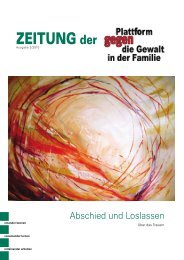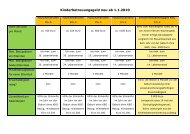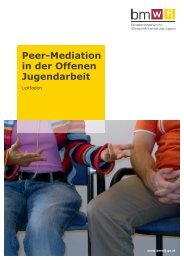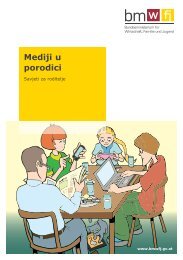Gewaltbericht - Kurzfassung - BMWA
Gewaltbericht - Kurzfassung - BMWA
Gewaltbericht - Kurzfassung - BMWA
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
estimmten Voraussetzungen sinnvoll sein kann, in<br />
anderen Fällen jedoch die Gefahr der Bagatellisierung<br />
der Übergriffe mit sich bringt.<br />
3. 1. 4. Opferrechte, Schadenersatz und<br />
Schmerzensgeld<br />
Derzeit sind Gewaltopfer im Strafverfahren nur<br />
ZeugInnen. Sie können sich zwar als Privatbeteiligte<br />
anschließen und Schmerzensgeld verlangen, doch<br />
werden sie meist von den Strafgerichten auf den<br />
Zivilrechtsweg verwiesen. Dies bedeutet, noch<br />
einmal einen Prozess durchstehen zu müssen – und<br />
dies auf eigenes Kostenrisiko. Da viele Opfer nicht<br />
noch ein weiteres Mal aussagen wollen, verzichten<br />
sie lieber auf ihre Ansprüche auf Schmerzensgeld.<br />
Benachteiligend ist auch der Umstand, dass Opfer<br />
von Gewalt derzeit keinen Anspruch auf kostenlose<br />
rechtliche Vertretung haben. Wenn sie sich als Privatbeteiligte<br />
dem Strafverfahren anschließen und<br />
eine anwaltliche Vertretung in Anspruch nehmen,<br />
müssen sie dafür selbst aufkommen. Sie können<br />
zwar versuchen, die Kosten vom Täter rückzufordern,<br />
in der Praxis gelingt dies jedoch selten,<br />
weil die Opfer dafür oft erneut einen Prozess<br />
anstrengen müssten.<br />
3. 1. 5. Änderungen im Ärztegesetz<br />
Bis zur Reform des Ärztegesetzes 1998 unterlagen<br />
ÄrztInnen der Anzeigepflicht, wenn sie im Rahmen<br />
ihrer Berufsausübung Kenntnis von Gewalttaten an<br />
PatientInnen erlangten. Mit den Änderungen im<br />
Ärztegesetz 1998 wurde die Anzeigepflicht in der<br />
alten Form abgeschafft und durch § 54 ÄrzteG<br />
ersetzt, der die Verschwiegenheits-, Melde- und<br />
Anzeigepflicht neu regelt.<br />
Nunmehr ist eine weitere Reform 46 durchgeführt<br />
worden, in der die Anzeigepflichten für ÄrztInnen im<br />
Vergleich zur vormals geltenden Regelung verschärft<br />
wurde.<br />
3. 2. Internationales Recht –<br />
Entwicklungen 1989-1999<br />
Die 90er-Jahre waren gekennzeichnet von zahlreichen<br />
internationalen Initiativen zur Sichtbarmachung<br />
und Eliminierung von Gewalt an Frauen.<br />
46 Vgl. 689 der Beilagen zu den Stenografischen Protokollen des Nationalrates XXI.GP.<br />
60<br />
1979: Konvention gegen jede Diskriminierung<br />
der Frau (CEDAW)<br />
Mehr als zehn Jahre lang war die Konvention gegen<br />
jede Diskriminierung der Frau, Convention on the<br />
Elimination of All Forms of Discrimination<br />
against Women (CEDAW), das einzige internationale<br />
Rechtsmittel, um Frauenrechte – und damit<br />
auch ein Frauenleben ohne Gewalt – auf nationaler<br />
und internationaler Ebene einzufordern. Österreich<br />
unterzeichnete die Konvention 1982, drei Jahre<br />
nachdem sie von der UN-Generalversammlung<br />
beschlossen worden war. Alle vier Jahre müssen<br />
die Staaten, die CEDAW unterzeichnet haben, dem<br />
CEDAW-Komitee einen Bericht über die Lage der<br />
Frau im Land vorlegen. Im Frühjahr 2000 war<br />
Österreich zum dritten Mal dazu aufgefordert, seine<br />
Bilanz vorzulegen. Eine Stärkung erfuhr die Konvention<br />
1999. Die Frauenstatuskommission<br />
(Commission on the Status of Women) der UNO<br />
beschloss im März ein Optional Protocol, das es<br />
nun auch Einzelpersonen ermöglicht, wegen Verstößen<br />
gegen die Konvention Beschwerde zu führen<br />
(Individualbeschwerdeverfahren).<br />
1993: Deklaration gegen Gewalt an Frauen<br />
Ein weiterer Schritt im Rahmen der UN-Mechanismen<br />
war die Verabschiedung der Deklaration gegen<br />
Gewalt an Frauen (Declaration on the Elimination of<br />
Violence against Women) im Dezember 1993, ein<br />
halbes Jahr nach der UN-Menschenrechtskonferenz<br />
in Wien. In sechs Artikeln werden die Staaten u.a.<br />
aufgefordert, verstärkt Maßnahmen zur Eliminierung<br />
von Gewalt gegen Frauen zu ergreifen.<br />
1994: Sonderberichterstatterin der<br />
UN-Menschenrechtskommission<br />
Mit der Ernennung von Radhika Coomaraswamy zur<br />
Sonderberichterstatterin über Gewalt an Frauen<br />
(Special Rapporteur on Violence against Women)<br />
bei der Menschenrechtskommission der Vereinten<br />
Nationen wurde eine zentrale Forderung internationaler<br />
Frauenorganisationen erfüllt. Seit ihrer<br />
Bestellung 1994 hat Coomaraswamy zahlreiche<br />
Berichte mit Empfehlungen vorgelegt, die rechtliche<br />
Maßnahmen zum Schutz von Frauen vor Gewalt<br />
vorschlagen. Von derselben Institution wurde 1998<br />
eine Resolution zur Eliminierung von Gewalt an<br />
Frauen beschlossen.