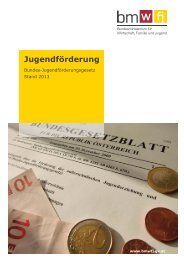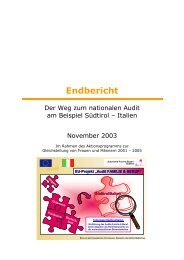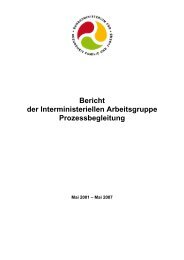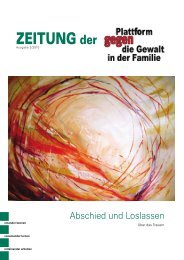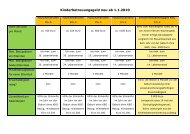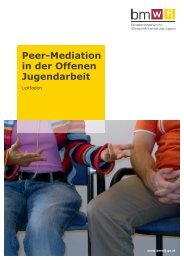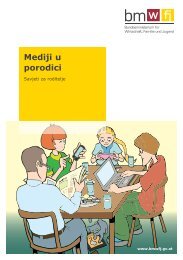Gewaltbericht - Kurzfassung - BMWA
Gewaltbericht - Kurzfassung - BMWA
Gewaltbericht - Kurzfassung - BMWA
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Abhängigkeit. Die Opfer sind auf Informationen des<br />
Misshandlers angewiesen und dieser kann ihnen<br />
alles weismachen, da sie häufig keine Möglichkeit<br />
zur Überprüfung haben. Dies kann zu einer verzerrten<br />
Wahrnehmung führen.<br />
Erschöpfung<br />
Gewalttäter versuchen die psychischen und<br />
physischen Kräfte des Opfers zu erschöpfen und<br />
damit seine Widerstandskraft zu schwächen, indem<br />
die Frau z.B. am Schlafen gehindert oder mit Arbeit<br />
überlastet wird.<br />
Abwertung der Person<br />
Beschimpfungen und Abwertungen schwächen das<br />
Selbstwertgefühl. Neben verschiedenen Demonstrationen<br />
von Macht werden manchmal auch sinnlose<br />
Handlungen erzwungen, die besonders<br />
erniedrigend sind.<br />
Das Opfer ist sich dieser Strategien meist nicht<br />
bewusst und tendiert dazu, bei sich die Schuld zu<br />
suchen. Zur Befreiung aus der Gewaltbeziehung und<br />
zur Bewältigung der Erfahrungen ist es daher auch<br />
notwendig, mit den betroffenen Frauen die<br />
Strategien von Gewaltausübung zu analysieren und<br />
Gegenstrategien zu entwickeln.<br />
1. 2. Rechtfertigungsversuche der Täter<br />
Victim blaming<br />
Victim blaming bedeutet, dem Opfer die Schuld und<br />
Verantwortung für die Gewalttat zuzuschieben. Es<br />
schützt und entlastet die Täter und dient der Aufrechterhaltung<br />
bestehender Machtverhältnisse.<br />
Victim blaming sorgt für ein gesellschaftliches Klima,<br />
in dem Gewalt an Frauen als verständliche und adäquate<br />
Reaktion auf das Verhalten des Opfers<br />
erscheint. Die Betroffenen werden in zweifacher<br />
Hinsicht Opfer: durch die Gewalttat und durch den<br />
Vorwurf, diese verursacht oder provoziert zu haben<br />
(sie hat nichts für ihn gekocht, einen zu kurzen<br />
Minirock getragen, ihren Mann betrogen, ...).<br />
Macht- und Dominanzanspruch gewalttätiger<br />
Männer<br />
Gewalttätige Männer sind oft davon überzeugt, dass<br />
der Mann in der Familie „das Sagen“ haben muss.<br />
Als Grund für die Gewalt geben sie z.B. an, dass die<br />
Partnerin nicht zu nörgeln aufgehört hat. Die Frau<br />
46<br />
wird durch die Misshandlungen zum Schweigen<br />
gebracht, Macht und Autorität werden auf diese<br />
Weise (wieder) hergestellt.<br />
Bagatellisierung der eigenen Gewalttätigkeit<br />
Die Analyse des Kontextes, in dem Gewalttaten<br />
verübt werden, wurde erst vergleichsweise spät als<br />
Forschungsthema aufgegriffen. Pionierarbeit in<br />
diesem Bereich leistete das britische Forscherehepaar<br />
Dobash. 34 Sie befragten sowohl Frauen als<br />
auch Männer und fanden heraus, dass Formen,<br />
Ausmaß und Häufigkeit der Gewalt von den<br />
Geschlechtern sehr unterschiedlich wahrgenommen<br />
werden. Nur bei „leichten“ Gewaltanwendungen<br />
stimmen Männer und Frauen in ihrer Einschätzung<br />
überein. Schwere Misshandlungen und ernsthafte<br />
Verletzungen werden dagegen, sowohl was das<br />
Ausmaß als auch die Häufigkeit betrifft, extrem<br />
unterschiedlich wahrgenommen. Dobash und<br />
Dobash begründen dies mit Abwehrstrategien, die<br />
sich der Täter zurecht legt, um die Verantwortung<br />
von sich zu weisen und sein Selbstwertgefühl hoch<br />
zu halten.<br />
1. 3. Täterprofile<br />
Kriminologische Arbeiten haben sich bisher überwiegend<br />
mit Verbrechen außerhalb der Familie<br />
beschäftigt. Über Gewalttäter im Familienverband<br />
existieren vergleichsweise wenige Untersuchungen.<br />
Die meisten Arbeiten gibt es zum Thema sexuelle<br />
Gewalt (v.a. Vergewaltigung), wobei hier die so<br />
genannten Fremdtäter im Vordergrund stehen.<br />
Männer, die ihre Ehefrauen oder Lebensgefährtinnen<br />
misshandeln, dürften in erhöhtem Maße von diesen<br />
abhängig sein. 35 Die Abhängigkeit wird nicht<br />
zugegeben bzw. ist sie dem Misshandler auch nicht<br />
bewusst. Sie zeigt sich vielmehr in kontrollierendem<br />
Verhalten, das darauf abzielt, die Freiheit der Frau<br />
zunehmend einzuschränken. Dieses Verhalten nennt<br />
die amerikanische Wissenschafterin Lenore Walker<br />
„social battering“. 36 Der Misshandler fühlt sich durch<br />
die Kontrolle über die Frau mächtig und überdeckt<br />
damit die eigene Unsicherheit und Abhängigkeit. Die<br />
Schuld für die Misshandlungen liegt in seiner Logik<br />
alleine bei der Frau, denn wenn sie sich „richtig“ verhalten<br />
würde, wären die Übergriffe nicht „nötig“.<br />
Für die Prävention von Gewalt und insbesondere für<br />
die Unterstützung der Opfer bei dem Schritt, eine<br />
34 Vgl. Dobash, R.E./ Dobash, R.P. (Ed.): Rethinking Violence against Women, Thousand Oaks/London/New Delhi 1998.<br />
35 Vgl. Godenzi, A.: Gewalt im sozialen Nahraum, Basel und Frankfurt am Main 1994.<br />
36 Vgl. Walker, L. E.: The battered women, New York 1979.