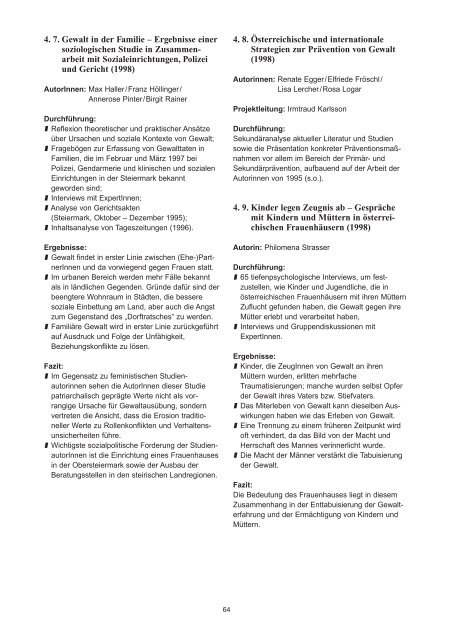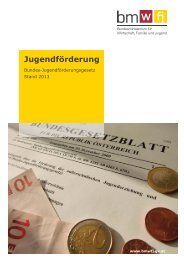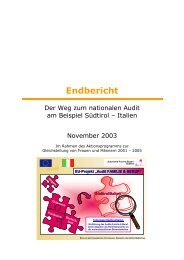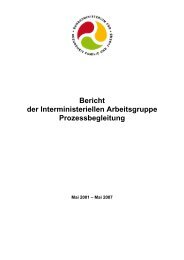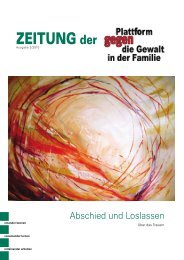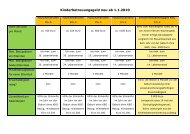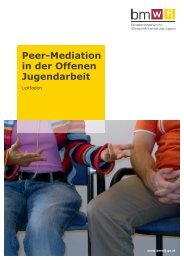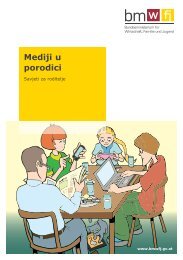Gewaltbericht - Kurzfassung - BMWA
Gewaltbericht - Kurzfassung - BMWA
Gewaltbericht - Kurzfassung - BMWA
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
4. 7. Gewalt in der Familie – Ergebnisse einer<br />
soziologischen Studie in Zusammenarbeit<br />
mit Sozialeinrichtungen, Polizei<br />
und Gericht (1998)<br />
AutorInnen: Max Haller/Franz Höllinger/<br />
Annerose Pinter/Birgit Rainer<br />
Durchführung:<br />
Reflexion theoretischer und praktischer Ansätze<br />
über Ursachen und soziale Kontexte von Gewalt;<br />
Fragebögen zur Erfassung von Gewalttaten in<br />
Familien, die im Februar und März 1997 bei<br />
Polizei, Gendarmerie und klinischen und sozialen<br />
Einrichtungen in der Steiermark bekannt<br />
geworden sind;<br />
Interviews mit ExpertInnen;<br />
Analyse von Gerichtsakten<br />
(Steiermark, Oktober – Dezember 1995);<br />
Inhaltsanalyse von Tageszeitungen (1996).<br />
Ergebnisse:<br />
Gewalt findet in erster Linie zwischen (Ehe-)PartnerInnen<br />
und da vorwiegend gegen Frauen statt.<br />
Im urbanen Bereich werden mehr Fälle bekannt<br />
als in ländlichen Gegenden. Gründe dafür sind der<br />
beengtere Wohnraum in Städten, die bessere<br />
soziale Einbettung am Land, aber auch die Angst<br />
zum Gegenstand des „Dorftratsches“ zu werden.<br />
Familiäre Gewalt wird in erster Linie zurückgeführt<br />
auf Ausdruck und Folge der Unfähigkeit,<br />
Beziehungskonflikte zu lösen.<br />
Fazit:<br />
Im Gegensatz zu feministischen Studienautorinnen<br />
sehen die AutorInnen dieser Studie<br />
patriarchalisch geprägte Werte nicht als vorrangige<br />
Ursache für Gewaltausübung, sondern<br />
vertreten die Ansicht, dass die Erosion traditioneller<br />
Werte zu Rollenkonflikten und Verhaltensunsicherheiten<br />
führe.<br />
Wichtigste sozialpolitische Forderung der StudienautorInnen<br />
ist die Einrichtung eines Frauenhauses<br />
in der Obersteiermark sowie der Ausbau der<br />
Beratungsstellen in den steirischen Landregionen.<br />
64<br />
4. 8. Österreichische und internationale<br />
Strategien zur Prävention von Gewalt<br />
(1998)<br />
Autorinnen: Renate Egger/Elfriede Fröschl/<br />
Lisa Lercher/Rosa Logar<br />
Projektleitung: Irmtraud Karlsson<br />
Durchführung:<br />
Sekundäranalyse aktueller Literatur und Studien<br />
sowie die Präsentation konkreter Präventionsmaßnahmen<br />
vor allem im Bereich der Primär- und<br />
Sekundärprävention, aufbauend auf der Arbeit der<br />
Autorinnen von 1995 (s.o.).<br />
4. 9. Kinder legen Zeugnis ab – Gespräche<br />
mit Kindern und Müttern in österreichischen<br />
Frauenhäusern (1998)<br />
Autorin: Philomena Strasser<br />
Durchführung:<br />
65 tiefenpsychologische Interviews, um festzustellen,<br />
wie Kinder und Jugendliche, die in<br />
österreichischen Frauenhäusern mit ihren Müttern<br />
Zuflucht gefunden haben, die Gewalt gegen ihre<br />
Mütter erlebt und verarbeitet haben,<br />
Interviews und Gruppendiskussionen mit<br />
ExpertInnen.<br />
Ergebnisse:<br />
Kinder, die ZeugInnen von Gewalt an ihren<br />
Müttern wurden, erlitten mehrfache<br />
Traumatisierungen; manche wurden selbst Opfer<br />
der Gewalt ihres Vaters bzw. Stiefvaters.<br />
Das Miterleben von Gewalt kann dieselben Auswirkungen<br />
haben wie das Erleben von Gewalt.<br />
Eine Trennung zu einem früheren Zeitpunkt wird<br />
oft verhindert, da das Bild von der Macht und<br />
Herrschaft des Mannes verinnerlicht wurde.<br />
Die Macht der Männer verstärkt die Tabuisierung<br />
der Gewalt.<br />
Fazit:<br />
Die Bedeutung des Frauenhauses liegt in diesem<br />
Zusammenhang in der Enttabuisierung der Gewalterfahrung<br />
und der Ermächtigung von Kindern und<br />
Müttern.