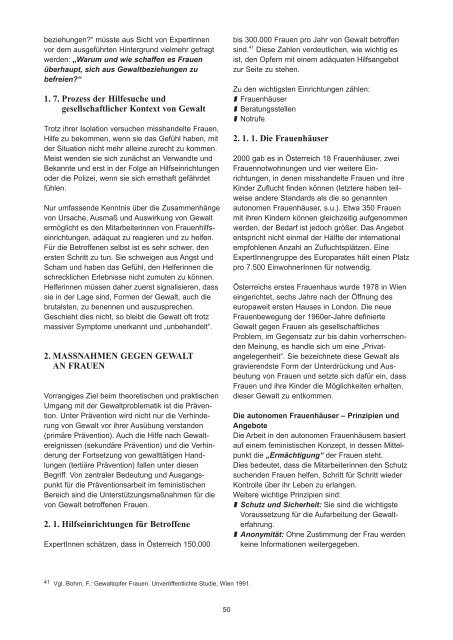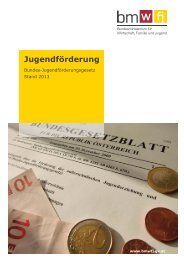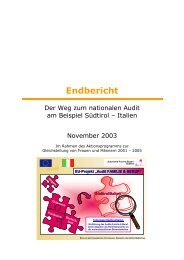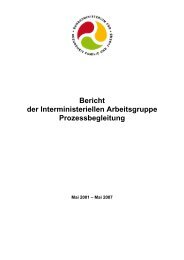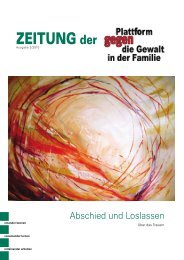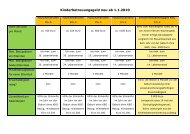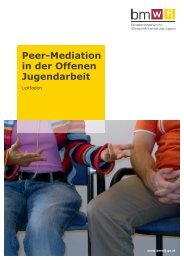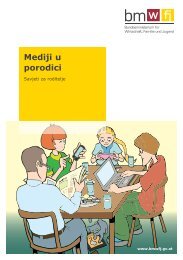Gewaltbericht - Kurzfassung - BMWA
Gewaltbericht - Kurzfassung - BMWA
Gewaltbericht - Kurzfassung - BMWA
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
eziehungen?“ müsste aus Sicht von ExpertInnen<br />
vor dem ausgeführten Hintergrund vielmehr gefragt<br />
werden: „Warum und wie schaffen es Frauen<br />
überhaupt, sich aus Gewaltbeziehungen zu<br />
befreien?“<br />
1. 7. Prozess der Hilfesuche und<br />
gesellschaftlicher Kontext von Gewalt<br />
Trotz ihrer Isolation versuchen misshandelte Frauen,<br />
Hilfe zu bekommen, wenn sie das Gefühl haben, mit<br />
der Situation nicht mehr alleine zurecht zu kommen.<br />
Meist wenden sie sich zunächst an Verwandte und<br />
Bekannte und erst in der Folge an Hilfseinrichtungen<br />
oder die Polizei, wenn sie sich ernsthaft gefährdet<br />
fühlen.<br />
Nur umfassende Kenntnis über die Zusammenhänge<br />
von Ursache, Ausmaß und Auswirkung von Gewalt<br />
ermöglicht es den Mitarbeiterinnen von Frauenhilfseinrichtungen,<br />
adäquat zu reagieren und zu helfen.<br />
Für die Betroffenen selbst ist es sehr schwer, den<br />
ersten Schritt zu tun. Sie schweigen aus Angst und<br />
Scham und haben das Gefühl, den Helferinnen die<br />
schrecklichen Erlebnisse nicht zumuten zu können.<br />
Helferinnen müssen daher zuerst signalisieren, dass<br />
sie in der Lage sind, Formen der Gewalt, auch die<br />
brutalsten, zu benennen und auszusprechen.<br />
Geschieht dies nicht, so bleibt die Gewalt oft trotz<br />
massiver Symptome unerkannt und „unbehandelt“.<br />
2. MASSNAHMEN GEGEN GEWALT<br />
AN FRAUEN<br />
Vorrangiges Ziel beim theoretischen und praktischen<br />
Umgang mit der Gewaltproblematik ist die Prävention.<br />
Unter Prävention wird nicht nur die Verhinderung<br />
von Gewalt vor ihrer Ausübung verstanden<br />
(primäre Prävention). Auch die Hilfe nach Gewaltereignissen<br />
(sekundäre Prävention) und die Verhinderung<br />
der Fortsetzung von gewalttätigen Handlungen<br />
(tertiäre Prävention) fallen unter diesen<br />
Begriff. Von zentraler Bedeutung und Ausgangspunkt<br />
für die Präventionsarbeit im feministischen<br />
Bereich sind die Unterstützungsmaßnahmen für die<br />
von Gewalt betroffenen Frauen.<br />
2. 1. Hilfseinrichtungen für Betroffene<br />
ExpertInnen schätzen, dass in Österreich 150.000<br />
41 Vgl. Bohrn, F.: Gewaltopfer Frauen. Unveröffentlichte Studie, Wien 1991.<br />
50<br />
bis 300.000 Frauen pro Jahr von Gewalt betroffen<br />
sind. 41 Diese Zahlen verdeutlichen, wie wichtig es<br />
ist, den Opfern mit einem adäquaten Hilfsangebot<br />
zur Seite zu stehen.<br />
Zu den wichtigsten Einrichtungen zählen:<br />
Frauenhäuser<br />
Beratungsstellen<br />
Notrufe<br />
2. 1. 1. Die Frauenhäuser<br />
2000 gab es in Österreich 18 Frauenhäuser, zwei<br />
Frauennotwohnungen und vier weitere Einrichtungen,<br />
in denen misshandelte Frauen und ihre<br />
Kinder Zuflucht finden können (letztere haben teilweise<br />
andere Standards als die so genannten<br />
autonomen Frauenhäuser, s.u.). Etwa 350 Frauen<br />
mit ihren Kindern können gleichzeitig aufgenommen<br />
werden, der Bedarf ist jedoch größer. Das Angebot<br />
entspricht nicht einmal der Hälfte der international<br />
empfohlenen Anzahl an Zufluchtsplätzen. Eine<br />
ExpertInnengruppe des Europarates hält einen Platz<br />
pro 7.500 EinwohnerInnen für notwendig.<br />
Österreichs erstes Frauenhaus wurde 1978 in Wien<br />
eingerichtet, sechs Jahre nach der Öffnung des<br />
europaweit ersten Hauses in London. Die neue<br />
Frauenbewegung der 1960er-Jahre definierte<br />
Gewalt gegen Frauen als gesellschaftliches<br />
Problem, im Gegensatz zur bis dahin vorherrschenden<br />
Meinung, es handle sich um eine „Privatangelegenheit“.<br />
Sie bezeichnete diese Gewalt als<br />
gravierendste Form der Unterdrückung und Ausbeutung<br />
von Frauen und setzte sich dafür ein, dass<br />
Frauen und ihre Kinder die Möglichkeiten erhalten,<br />
dieser Gewalt zu entkommen.<br />
Die autonomen Frauenhäuser – Prinzipien und<br />
Angebote<br />
Die Arbeit in den autonomen Frauenhäusern basiert<br />
auf einem feministischen Konzept, in dessen Mittelpunkt<br />
die „Ermächtigung“ der Frauen steht.<br />
Dies bedeutet, dass die Mitarbeiterinnen den Schutz<br />
suchenden Frauen helfen, Schritt für Schritt wieder<br />
Kontrolle über ihr Leben zu erlangen.<br />
Weitere wichtige Prinzipien sind:<br />
Schutz und Sicherheit: Sie sind die wichtigste<br />
Voraussetzung für die Aufarbeitung der Gewalterfahrung.<br />
Anonymität: Ohne Zustimmung der Frau werden<br />
keine Informationen weitergegeben.