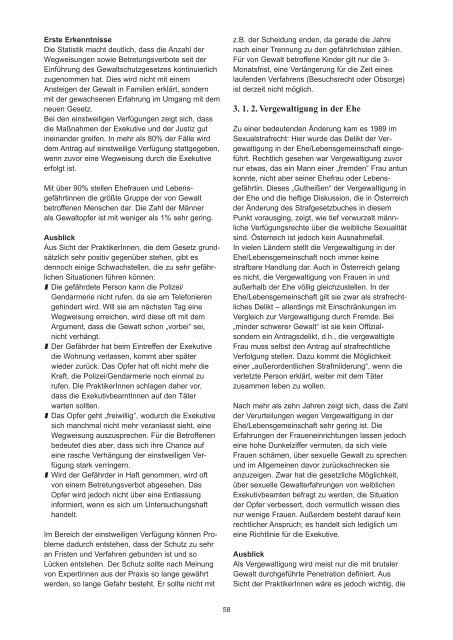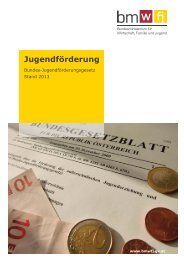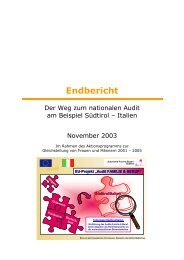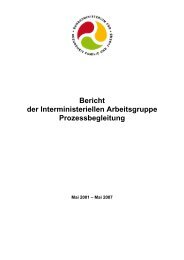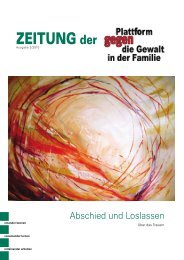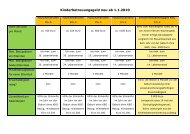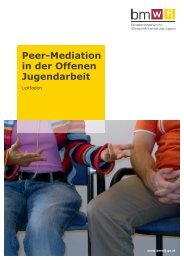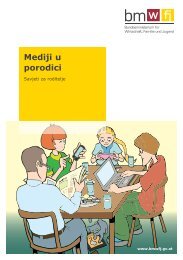Gewaltbericht - Kurzfassung - BMWA
Gewaltbericht - Kurzfassung - BMWA
Gewaltbericht - Kurzfassung - BMWA
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Erste Erkenntnisse<br />
Die Statistik macht deutlich, dass die Anzahl der<br />
Wegweisungen sowie Betretungsverbote seit der<br />
Einführung des Gewaltschutzgesetzes kontinuierlich<br />
zugenommen hat. Dies wird nicht mit einem<br />
Ansteigen der Gewalt in Familien erklärt, sondern<br />
mit der gewachsenen Erfahrung im Umgang mit dem<br />
neuen Gesetz.<br />
Bei den einstweiligen Verfügungen zeigt sich, dass<br />
die Maßnahmen der Exekutive und der Justiz gut<br />
ineinander greifen. In mehr als 80% der Fälle wird<br />
dem Antrag auf einstweilige Verfügung stattgegeben,<br />
wenn zuvor eine Wegweisung durch die Exekutive<br />
erfolgt ist.<br />
Mit über 90% stellen Ehefrauen und Lebensgefährtinnen<br />
die größte Gruppe der von Gewalt<br />
betroffenen Menschen dar. Die Zahl der Männer<br />
als Gewaltopfer ist mit weniger als 1% sehr gering.<br />
Ausblick<br />
Aus Sicht der PraktikerInnen, die dem Gesetz grundsätzlich<br />
sehr positiv gegenüber stehen, gibt es<br />
dennoch einige Schwachstellen, die zu sehr gefährlichen<br />
Situationen führen können:<br />
Die gefährdete Person kann die Polizei/<br />
Gendarmerie nicht rufen, da sie am Telefonieren<br />
gehindert wird. Will sie am nächsten Tag eine<br />
Wegweisung erreichen, wird diese oft mit dem<br />
Argument, dass die Gewalt schon „vorbei“ sei,<br />
nicht verhängt.<br />
Der Gefährder hat beim Eintreffen der Exekutive<br />
die Wohnung verlassen, kommt aber später<br />
wieder zurück. Das Opfer hat oft nicht mehr die<br />
Kraft, die Polizei/Gendarmerie noch einmal zu<br />
rufen. Die PraktikerInnen schlagen daher vor,<br />
dass die ExekutivbeamtInnen auf den Täter<br />
warten sollten.<br />
Das Opfer geht „freiwillig“, wodurch die Exekutive<br />
sich manchmal nicht mehr veranlasst sieht, eine<br />
Wegweisung auszusprechen. Für die Betroffenen<br />
bedeutet dies aber, dass sich ihre Chance auf<br />
eine rasche Verhängung der einstweiligen Verfügung<br />
stark verringern.<br />
Wird der Gefährder in Haft genommen, wird oft<br />
von einem Betretungsverbot abgesehen. Das<br />
Opfer wird jedoch nicht über eine Entlassung<br />
informiert, wenn es sich um Untersuchungshaft<br />
handelt.<br />
Im Bereich der einstweiligen Verfügung können Probleme<br />
dadurch entstehen, dass der Schutz zu sehr<br />
an Fristen und Verfahren gebunden ist und so<br />
Lücken entstehen. Der Schutz sollte nach Meinung<br />
von ExpertInnen aus der Praxis so lange gewährt<br />
werden, so lange Gefahr besteht. Er sollte nicht mit<br />
58<br />
z.B. der Scheidung enden, da gerade die Jahre<br />
nach einer Trennung zu den gefährlichsten zählen.<br />
Für von Gewalt betroffene Kinder gilt nur die 3-<br />
Monatsfrist, eine Verlängerung für die Zeit eines<br />
laufenden Verfahrens (Besuchsrecht oder Obsorge)<br />
ist derzeit nicht möglich.<br />
3. 1. 2. Vergewaltigung in der Ehe<br />
Zu einer bedeutenden Änderung kam es 1989 im<br />
Sexualstrafrecht: Hier wurde das Delikt der Vergewaltigung<br />
in der Ehe/Lebensgemeinschaft eingeführt.<br />
Rechtlich gesehen war Vergewaltigung zuvor<br />
nur etwas, das ein Mann einer „fremden“ Frau antun<br />
konnte, nicht aber seiner Ehefrau oder Lebensgefährtin.<br />
Dieses „Gutheißen“ der Vergewaltigung in<br />
der Ehe und die heftige Diskussion, die in Österreich<br />
der Änderung des Strafgesetzbuches in diesem<br />
Punkt vorausging, zeigt, wie tief verwurzelt männliche<br />
Verfügungsrechte über die weibliche Sexualität<br />
sind. Österreich ist jedoch kein Ausnahmefall.<br />
In vielen Ländern stellt die Vergewaltigung in der<br />
Ehe/Lebensgemeinschaft noch immer keine<br />
strafbare Handlung dar. Auch in Österreich gelang<br />
es nicht, die Vergewaltigung von Frauen in und<br />
außerhalb der Ehe völlig gleichzustellen. In der<br />
Ehe/Lebensgemeinschaft gilt sie zwar als strafrechtliches<br />
Delikt – allerdings mit Einschränkungen im<br />
Vergleich zur Vergewaltigung durch Fremde. Bei<br />
„minder schwerer Gewalt“ ist sie kein Offizialsondern<br />
ein Antragsdelikt, d.h., die vergewaltigte<br />
Frau muss selbst den Antrag auf strafrechtliche<br />
Verfolgung stellen. Dazu kommt die Möglichkeit<br />
einer „außerordentlichen Strafmilderung“, wenn die<br />
verletzte Person erklärt, weiter mit dem Täter<br />
zusammen leben zu wollen.<br />
Nach mehr als zehn Jahren zeigt sich, dass die Zahl<br />
der Verurteilungen wegen Vergewaltigung in der<br />
Ehe/Lebensgemeinschaft sehr gering ist. Die<br />
Erfahrungen der Fraueneinrichtungen lassen jedoch<br />
eine hohe Dunkelziffer vermuten, da sich viele<br />
Frauen schämen, über sexuelle Gewalt zu sprechen<br />
und im Allgemeinen davor zurückschrecken sie<br />
anzuzeigen. Zwar hat die gesetzliche Möglichkeit,<br />
über sexuelle Gewalterfahrungen von weiblichen<br />
Exekutivbeamten befragt zu werden, die Situation<br />
der Opfer verbessert, doch vermutlich wissen dies<br />
nur wenige Frauen. Außerdem besteht darauf kein<br />
rechtlicher Anspruch; es handelt sich lediglich um<br />
eine Richtlinie für die Exekutive.<br />
Ausblick<br />
Als Vergewaltigung wird meist nur die mit brutaler<br />
Gewalt durchgeführte Penetration definiert. Aus<br />
Sicht der PraktikerInnen wäre es jedoch wichtig, die