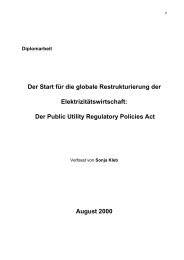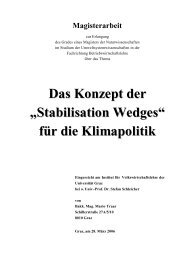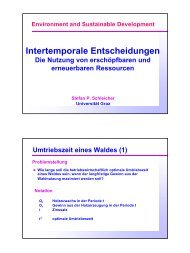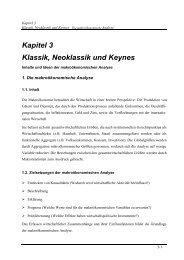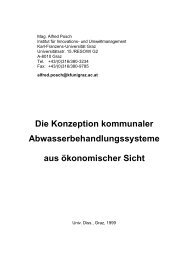Die Liberalisierung des österreichischen Rundfunkmarkts - Stefan ...
Die Liberalisierung des österreichischen Rundfunkmarkts - Stefan ...
Die Liberalisierung des österreichischen Rundfunkmarkts - Stefan ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
II <strong>Die</strong> theoretische Fundierung von Regulierungsfragen<br />
vielen Personen gleichzeitig konsumiert werden kann, ohne dass der Konsum einer Person<br />
den Konsum anderer Personen beschränken würde. Von Nichtexklusivität oder von einem<br />
Versagen <strong>des</strong> Marktausschlussprinzips kann dann gesprochen werden, wenn potentielle<br />
Kunden nicht von der Nutzung <strong>des</strong> entsprechenden Gutes ausgeschlossen werden können.<br />
<strong>Die</strong>s hat insbesondere zur Folge, dass Preisforderungen nicht durchsetzbar sind. Da ein<br />
Konsument immer auch als sogenannter „Free-Rider“ in den Genuss <strong>des</strong> fraglichen Gutes<br />
kommen kann, wird er bei ökonomisch-rationaler Handlungsausrichtung keine Zahlung<br />
leisten. Vor diesem Hintergrund ist es selbstverständlich, dass werbefinanzierte<br />
Rundfunkveranstalter nicht mit ihrem Publikum in eine wirtschaftliche Tauschbeziehung<br />
treten, sondern mit der werbenden Wirtschaft. Es geht gar nicht mehr in erster Linie um die<br />
Produktion von Rundfunkinhalten, sondern um den Verkauf von Zuschaueraufmerksamkeit.<br />
Programminhalte sind bei dieser Sachlage- strikt ökonomisch betrachtet – lediglich Mittel<br />
zum Zweck, kein Ziel in sich selbst.<br />
Ein weiteres Merkmal <strong>des</strong> Rundfunks ist die ausgeprägte Bedeutung der Fixkostendegression,<br />
da bei der Produktion von Radio- und Fernsehprogrammen fast ausschließlich Fixkosten<br />
anfallen. Ist ein Programm einmal produziert, enstehen keine Zusatzkosten, wenn ein<br />
Rezipient zusätzlich sein Empfangsgerät einschaltet oder das Programm länger konsumiert als<br />
bisher. Ökonomisch formuliert: <strong>Die</strong> Grenzkosten der Rundfunkproduktion sind gleich Null.<br />
<strong>Die</strong>ses Phänomen steht in engem Zusammenhang mit der Nichtrivalität beim Konsum von<br />
Rundfunkprogrammen.<br />
Ein Veranstalter muss bei dieser Konstellation aus ökonomischen Gründen sein Verhalten<br />
darauf ausrichten, ein möglichst zahlreiches Publikum anzusprechen, um einerseits<br />
Stückkostenvorteile bei der Produktion zu erlangen und andererseits der werbenden<br />
Wirtschaft eine möglichst grosse Zahl an Publikumskontakten anbieten zu können.<br />
Rundfunkveranstalter sind also in ausgeprägtem Masse auf sogenannte Skaleneffekte<br />
angewiesen, die am ehesten mit massenattraktiven Programmen und unter Verzicht auf<br />
Befriedigung spezieller Programmwünsche von Minderheiten realisiert werden können. 19<br />
<strong>Die</strong> Wahrscheinlichkeit, dass das System von Radio und Fernsehen unter solchen<br />
Bedingungen die gesellschaftlich und verfassungsmässig geforderten Leistungen in<br />
hinreichendem Masse erbringt, ist gering. Je stärker die kommerzielle Ausrichtung von<br />
Rundfunkveranstaltern, <strong>des</strong>to stärker die Tendenz, dass die ökonomischen Ziele mit den<br />
„ideellen“ oder kommunikativen Zielsetzungen in Konflikt geraten.<br />
19 Vgl. Abele (Beiträge zur Rundfunkökonomie 7, 2001), S. 59f.<br />
11