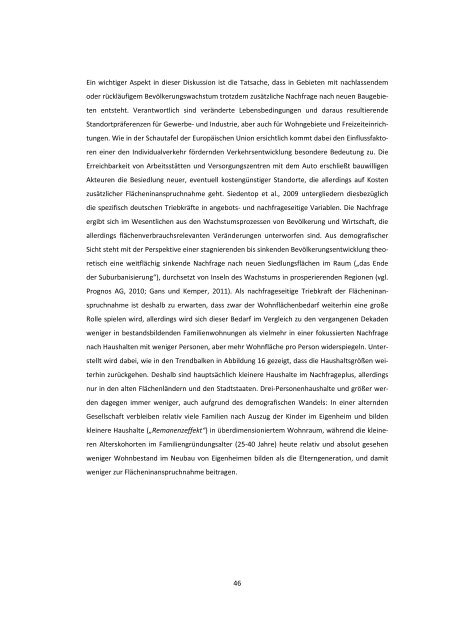PDF 20.134kB - TOBIAS-lib - Universität Tübingen
PDF 20.134kB - TOBIAS-lib - Universität Tübingen
PDF 20.134kB - TOBIAS-lib - Universität Tübingen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Ein wichtiger Aspekt in dieser Diskussion ist die Tatsache, dass in Gebieten mit nachlassendem<br />
oder rückläufigem Bevölkerungswachstum trotzdem zusätzliche Nachfrage nach neuen Baugebie-<br />
ten entsteht. Verantwortlich sind veränderte Lebensbedingungen und daraus resultierende<br />
Standortpräferenzen für Gewerbe- und Industrie, aber auch für Wohngebiete und Freizeiteinrich-<br />
tungen. Wie in der Schautafel der Europäischen Union ersichtlich kommt dabei den Einflussfakto-<br />
ren einer den Individualverkehr fördernden Verkehrsentwicklung besondere Bedeutung zu. Die<br />
Erreichbarkeit von Arbeitsstätten und Versorgungszentren mit dem Auto erschließt bauwilligen<br />
Akteuren die Besiedlung neuer, eventuell kostengünstiger Standorte, die allerdings auf Kosten<br />
zusätzlicher Flächeninanspruchnahme geht. Siedentop et al., 2009 untergliedern diesbezüglich<br />
die spezifisch deutschen Triebkräfte in angebots- und nachfrageseitige Variablen. Die Nachfrage<br />
ergibt sich im Wesentlichen aus den Wachstumsprozessen von Bevölkerung und Wirtschaft, die<br />
allerdings flächenverbrauchsrelevanten Veränderungen unterworfen sind. Aus demografischer<br />
Sicht steht mit der Perspektive einer stagnierenden bis sinkenden Bevölkerungsentwicklung theo-<br />
retisch eine weitflächig sinkende Nachfrage nach neuen Siedlungsflächen im Raum („das Ende<br />
der Suburbanisierung“), durchsetzt von Inseln des Wachstums in prosperierenden Regionen (vgl.<br />
Prognos AG, 2010; Gans und Kemper, 2011). Als nachfrageseitige Triebkraft der Flächeninan-<br />
spruchnahme ist deshalb zu erwarten, dass zwar der Wohnflächenbedarf weiterhin eine große<br />
Rolle spielen wird, allerdings wird sich dieser Bedarf im Vergleich zu den vergangenen Dekaden<br />
weniger in bestandsbildenden Familienwohnungen als vielmehr in einer fokussierten Nachfrage<br />
nach Haushalten mit weniger Personen, aber mehr Wohnfläche pro Person widerspiegeln. Unter-<br />
stellt wird dabei, wie in den Trendbalken in Abbildung 16 gezeigt, dass die Haushaltsgrößen wei-<br />
terhin zurückgehen. Deshalb sind hauptsächlich kleinere Haushalte im Nachfrageplus, allerdings<br />
nur in den alten Flächenländern und den Stadtstaaten. Drei-Personenhaushalte und größer wer-<br />
den dagegen immer weniger, auch aufgrund des demografischen Wandels: In einer alternden<br />
Gesellschaft verbleiben relativ viele Familien nach Auszug der Kinder im Eigenheim und bilden<br />
kleinere Haushalte („Remanenzeffekt“) in überdimensioniertem Wohnraum, während die kleine-<br />
ren Alterskohorten im Familiengründungsalter (25-40 Jahre) heute relativ und absolut gesehen<br />
weniger Wohnbestand im Neubau von Eigenheimen bilden als die Elterngeneration, und damit<br />
weniger zur Flächeninanspruchnahme beitragen.<br />
46