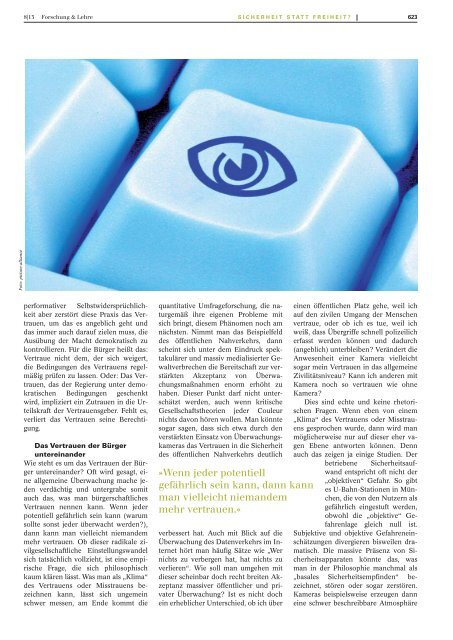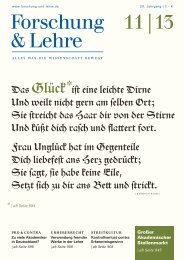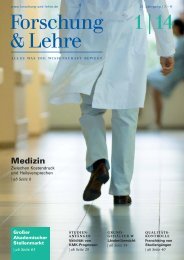Forschung & Lehre 8 | 2013
Forschung & Lehre 8 | 2013
Forschung & Lehre 8 | 2013
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
8|13 <strong>Forschung</strong> & <strong>Lehre</strong> SICHERHEIT STATT FREIHEIT? 623<br />
Foto: picture-alliance<br />
performativer Selbstwidersprüchlichkeit<br />
aber zerstört diese Praxis das Vertrauen,<br />
um das es angeblich geht und<br />
das immer auch darauf zielen muss, die<br />
Ausübung der Macht demokratisch zu<br />
kontrollieren. Für die Bürger heißt das:<br />
Vertraue nicht dem, der sich weigert,<br />
die Bedingungen des Vertrauens regelmäßig<br />
prüfen zu lassen. Oder: Das Vertrauen,<br />
das der Regierung unter demokratischen<br />
Bedingungen geschenkt<br />
wird, impliziert ein Zutrauen in die Urteilskraft<br />
der Vertrauensgeber. Fehlt es,<br />
verliert das Vertrauen seine Berechtigung.<br />
Das Vertrauen der Bürger<br />
untereinander<br />
Wie steht es um das Vertrauen der Bürger<br />
untereinander? Oft wird gesagt, eine<br />
allgemeine Überwachung mache jeden<br />
verdächtig und untergrabe somit<br />
auch das, was man bürgerschaftliches<br />
Vertrauen nennen kann. Wenn jeder<br />
potentiell gefährlich sein kann (warum<br />
sollte sonst jeder überwacht werden?),<br />
dann kann man vielleicht niemandem<br />
mehr vertrauen. Ob dieser radikale zivilgesellschaftliche<br />
Einstellungswandel<br />
sich tatsächlich vollzieht, ist eine empirische<br />
Frage, die sich philosophisch<br />
kaum klären lässt. Was man als „Klima“<br />
des Vertrauens oder Misstrauens bezeichnen<br />
kann, lässt sich ungemein<br />
schwer messen, am Ende kommt die<br />
quantitative Umfrageforschung, die naturgemäß<br />
ihre eigenen Probleme mit<br />
sich bringt, diesem Phänomen noch am<br />
nächsten. Nimmt man das Beispielfeld<br />
des öffentlichen Nahverkehrs, dann<br />
scheint sich unter dem Eindruck spektakulärer<br />
und massiv medialisierter Gewaltverbrechen<br />
die Bereitschaft zur verstärkten<br />
Akzeptanz von Überwachungsmaßnahmen<br />
enorm erhöht zu<br />
haben. Dieser Punkt darf nicht unterschätzt<br />
werden, auch wenn kritische<br />
Gesellschaftstheorien jeder Couleur<br />
nichts davon hören wollen. Man könnte<br />
sogar sagen, dass sich etwa durch den<br />
verstärkten Einsatz von Überwachungskameras<br />
das Vertrauen in die Sicherheit<br />
des öffentlichen Nahverkehrs deutlich<br />
»Wenn jeder potentiell<br />
gefährlich sein kann, dann kann<br />
man vielleicht niemandem<br />
mehr vertrauen.«<br />
verbessert hat. Auch mit Blick auf die<br />
Überwachung des Datenverkehrs im Internet<br />
hört man häufig Sätze wie „Wer<br />
nichts zu verbergen hat, hat nichts zu<br />
verlieren“. Wie soll man umgehen mit<br />
dieser scheinbar doch recht breiten Akzeptanz<br />
massiver öffentlicher und privater<br />
Überwachung? Ist es nicht doch<br />
ein erheblicher Unterschied, ob ich über<br />
einen öffentlichen Platz gehe, weil ich<br />
auf den zivilen Umgang der Menschen<br />
vertraue, oder ob ich es tue, weil ich<br />
weiß, dass Übergriffe schnell polizeilich<br />
erfasst werden können und dadurch<br />
(angeblich) unterbleiben? Verändert die<br />
Anwesenheit einer Kamera vielleicht<br />
sogar mein Vertrauen in das allgemeine<br />
Zivilitätsniveau? Kann ich anderen mit<br />
Kamera noch so vertrauen wie ohne<br />
Kamera?<br />
Dies sind echte und keine rhetorischen<br />
Fragen. Wenn eben von einem<br />
„Klima“ des Vertrauens oder Misstrauens<br />
gesprochen wurde, dann wird man<br />
möglicherweise nur auf dieser eher vagen<br />
Ebene antworten können. Denn<br />
auch das zeigen ja einige Studien. Der<br />
betriebene Sicherheitsaufwand<br />
entspricht oft nicht der<br />
„objektiven“ Gefahr. So gibt<br />
es U-Bahn-Stationen in München,<br />
die von den Nutzern als<br />
gefährlich eingestuft werden,<br />
obwohl die „objektive“ Gefahrenlage<br />
gleich null ist.<br />
Subjektive und objektive Gefahreneinschätzungen<br />
divergieren bisweilen dramatisch.<br />
Die massive Präsenz von Sicherheitsapparaten<br />
könnte das, was<br />
man in der Philosophie manchmal als<br />
„basales Sicherheitsempfinden“ bezeichnet,<br />
stören oder sogar zerstören.<br />
Kameras beispielsweise erzeugen dann<br />
eine schwer beschreibbare Atmosphäre