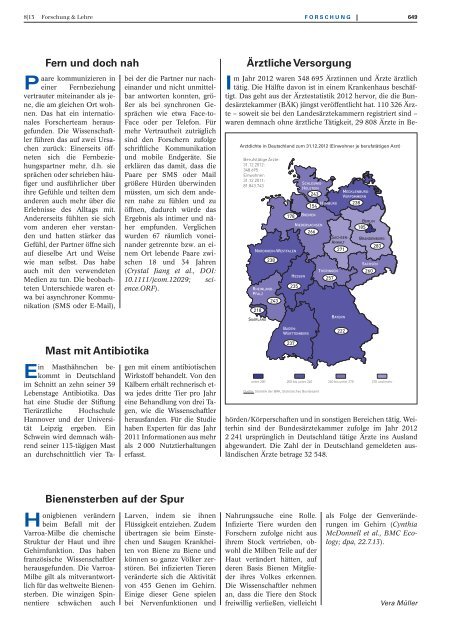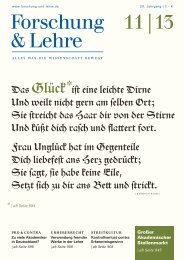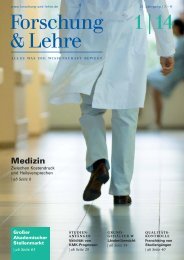Forschung & Lehre 8 | 2013
Forschung & Lehre 8 | 2013
Forschung & Lehre 8 | 2013
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
8|13 <strong>Forschung</strong> & <strong>Lehre</strong> FORSCHUNG 649<br />
Fern und doch nah<br />
Paare kommunizieren in<br />
einer Fernbeziehung<br />
vertrauter miteinander als jene,<br />
die am gleichen Ort wohnen.<br />
Das hat ein internationales<br />
Forscherteam herausgefunden.<br />
Die Wissenschaftler<br />
führen das auf zwei Ursachen<br />
zurück: Einerseits öffneten<br />
sich die Fernbeziehungspartner<br />
mehr, d.h. sie<br />
sprächen oder schrieben häufiger<br />
und ausführlicher über<br />
ihre Gefühle und teilten dem<br />
anderen auch mehr über die<br />
Erlebnisse des Alltags mit.<br />
Andererseits fühlten sie sich<br />
vom anderen eher verstanden<br />
und hatten stärker das<br />
Gefühl, der Partner öffne sich<br />
auf dieselbe Art und Weise<br />
wie man selbst. Das habe<br />
auch mit den verwendeten<br />
Medien zu tun. Die beobachteten<br />
Unterschiede waren etwa<br />
bei asynchroner Kommunikation<br />
(SMS oder E-Mail),<br />
bei der die Partner nur nacheinander<br />
und nicht unmittelbar<br />
antworten konnten, größer<br />
als bei synchronen Gesprächen<br />
wie etwa Face-to-<br />
Face oder per Telefon. Für<br />
mehr Vertrautheit zuträglich<br />
sind den Forschern zufolge<br />
schriftliche Kommunikation<br />
und mobile Endgeräte. Sie<br />
erklären das damit, dass die<br />
Paare per SMS oder Mail<br />
größere Hürden überwinden<br />
müssten, um sich dem anderen<br />
nahe zu fühlen und zu<br />
öffnen, dadurch würde das<br />
Ergebnis als intimer und näher<br />
empfunden. Verglichen<br />
wurden 67 räumlich voneinander<br />
getrennte bzw. an einem<br />
Ort lebende Paare zwischen<br />
18 und 34 Jahren<br />
(Crystal Jiang et al., DOI:<br />
10.1111/jcom.12029; science.ORF).<br />
Ärztliche Versorgung<br />
Arztdichte in Deutschland zum 31.12.2012 (Einwohner je berufstätigen Arzt)<br />
Mast mit Antibiotika<br />
Ein Masthähnchen bekommt<br />
in Deutschland<br />
im Schnitt an zehn seiner 39<br />
Lebenstage Antibiotika. Das<br />
hat eine Studie der Stiftung<br />
Tierärztliche Hochschule<br />
Hannover und der Universität<br />
Leipzig ergeben. Ein<br />
Schwein wird demnach während<br />
seiner 115-tägigen Mast<br />
an durchschnittlich vier Tagen<br />
mit einem antibiotischen<br />
Wirkstoff behandelt. Von den<br />
Kälbern erhält rechnerisch etwa<br />
jedes dritte Tier pro Jahr<br />
eine Behandlung von drei Tagen,<br />
wie die Wissenschaftler<br />
herausfanden. Für die Studie<br />
haben Experten für das Jahr<br />
2011 Informationen aus mehr<br />
als 2 000 Nutztierhaltungen<br />
erfasst.<br />
Im Jahr 2012 waren 348 695 Ärztinnen und Ärzte ärztlich<br />
tätig. Die Hälfte davon ist in einem Krankenhaus beschäftigt.<br />
Das geht aus der Ärztestatistik 2012 hervor, die die Bundesärztekammer<br />
(BÄK) jüngst veröffentlicht hat. 110 326 Ärzte<br />
– soweit sie bei den Landesärztekammern registriert sind –<br />
waren demnach ohne ärztliche Tätigkeit, 29 808 Ärzte in Behörden/Körperschaften<br />
und in sonstigen Bereichen tätig. Weiterhin<br />
sind der Bundesärztekammer zufolge im Jahr 2012<br />
2 241 ursprünglich in Deutschland tätige Ärzte ins Ausland<br />
abgewandert. Die Zahl der in Deutschland gemeldeten ausländischen<br />
Ärzte betrage 32 548.<br />
Bienensterben auf der Spur<br />
Honigbienen verändern<br />
beim Befall mit der<br />
Varroa-Milbe die chemische<br />
Struktur der Haut und ihre<br />
Gehirnfunktion. Das haben<br />
französische Wissenschaftler<br />
herausgefunden. Die Varroa-<br />
Milbe gilt als mitverantwortlich<br />
für das weltweite Bienensterben.<br />
Die winzigen Spinnentiere<br />
schwächen auch<br />
Larven, indem sie ihnen<br />
Flüssigkeit entziehen. Zudem<br />
übertragen sie beim Einstechen<br />
und Saugen Krankheiten<br />
von Biene zu Biene und<br />
können so ganze Völker zerstören.<br />
Bei infizierten Tieren<br />
veränderte sich die Aktivität<br />
von 455 Genen im Gehirn.<br />
Einige dieser Gene spielen<br />
bei Nervenfunktionen und<br />
Nahrungssuche eine Rolle.<br />
Infizierte Tiere wurden den<br />
Forschern zufolge nicht aus<br />
ihrem Stock vertrieben, obwohl<br />
die Milben Teile auf der<br />
Haut verändert hätten, auf<br />
deren Basis Bienen Mitglieder<br />
ihres Volkes erkennen.<br />
Die Wissenschaftler nehmen<br />
an, dass die Tiere den Stock<br />
freiwillig verließen, vielleicht<br />
als Folge der Genveränderungen<br />
im Gehirn (Cynthia<br />
McDonnell et al., BMC Ecology;<br />
dpa, 22.7.13).<br />
Vera Müller