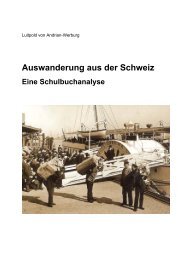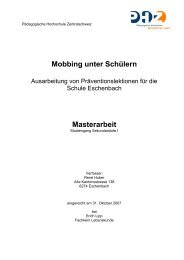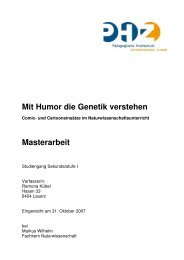Bausteinheft 5 - Sekundarstufe I
Bausteinheft 5 - Sekundarstufe I
Bausteinheft 5 - Sekundarstufe I
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<br />
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy<br />
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<br />
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy<br />
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<br />
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy<br />
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<br />
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy<br />
Registrierung<br />
Lernsituation<br />
Mögliche Lernsituationen<br />
an den<br />
Praxisschulen<br />
Mögliche Lernsituationen<br />
an<br />
der PHZ<br />
Schülerbeobachtung haben zwar nur wenig Verbreitung gefunden. Dies kann einerseits<br />
darauf zurückgeführt werden, dass Unkenntnis darüber besteht, dass es solche Hilfen<br />
gibt, andererseits dürften Lehrpersonen angesichts ihrer pädagogischen Aufgaben eine<br />
zu grosse Belastung im Einsatz solcher Methoden sehen. Um Beobachtungen jedoch<br />
zuverlässiger und gültiger zu gestalten, ist dies der richtige Weg. Ein Beobachtungsbogen<br />
ist nur brauchbar und wird dann eingesetzt werden, wenn er im Unterrichts- und Arbeitsalltag<br />
gut anwendbar ist. Dies hängt u.a. von der Formulierung der einzelnen Beobachtungskriterien<br />
ab. Diese Kriterien sollten über beobachtbare oder überprüfbare Indikatoren<br />
konkretisiert werden. Bohl (2004) führt für den offenen Unterricht als Beispiel folgendes<br />
Lernziel auf: «Der Schüler/die Schülerin ist in der Lage, den Hellraum-Projektor gezielt<br />
einzusetzen.» Wer beobachten will, ob dieses Ziel wirklich erreicht wurde, muss erst einmal<br />
festlegen, woran dies zu erkennen ist, d.h. ein Beobachter muss Merkmale bzw.<br />
Kategorien für seine Beobachtung bestimmen. Von der Genauigkeit und Sorgfalt, mit der<br />
Merkmale bzw. Kategorien und Kriterien beschrieben werden, hängt die Güte der Beobachtung<br />
in hohem Masse ab. Werden die Kriterien zu allgemein formuliert (z.B. «… kann<br />
Medien gezielt einsetzen») oder zu konkret (z.B. «… kann beim Hellraum-Projektor Schärfe<br />
einstellen»), dann ist das Kriterium wie im ersten Fall nicht beobachtbar oder wie im<br />
zweiten Fall zu wenig aussagekräftig. Für das Ziel «Der Schüler/die Schülerin ist in der Lage,<br />
den Hellraum-Projektor gezielt einzusetzen» lassen sich z.B. drei Kategorien unterscheiden:<br />
• Gestaltung der eingesetzten Folien (mögliche Indikatoren: Lesbarkeit, Übersicht, Aussagekraft,<br />
Einsatz von Symbolen, Farben, Strukturierungshilfen, kreative Elemente).<br />
•Einsatz der Folien (mögliche Indikatoren; sinnvolles Abdecken, Lesbarkeit und Schärfe<br />
überprüfen, Einsatz im Präsentationsverlauf).<br />
• Bezug zum Thema.<br />
Wenn nicht das Vorkommen eines Merkmals registriert werden soll (Strichliste), sondern<br />
eingestuft werden soll, in welchem Grad ein Merkmal oder eine Eigenschaft vorhanden<br />
ist, werden Schätzskalen (Ratingskalen) eingesetzt. Oft sind dabei hoch inferente Urteile<br />
abzugeben. Beispiel für ein hoch inferentes Urteil: «Wie interessiert ist der Schüler am<br />
Unterricht?» (Skaleneinteilung: gar nicht interessiert – kaum interessiert – etwas interessiert<br />
– sehr interessiert – brennend interessiert). Bei solchen hoch inferenten Schätzskalen ist<br />
es den Beobachtern meist überlassen, was diese unter dem einzuschätzenden Urteil verstehen.<br />
So dürften Lehrpersonen unter «Interesse am Unterricht» verschiedenes verstehen.<br />
Um die Objektivität, Zuverlässigkeit und Gültigkeit von Beobachtungen zu erhöhen,<br />
ist es jedoch unverzichtbar, wenn an die Stelle von hoch inferenten Urteilen konkrete<br />
Beobachtungen von Verhalten treten.<br />
Die Beobachtungen können in einem Karteikartensystem, in einem pädagogischen Tagebuch,<br />
in einem Merkmalsbogen etc. festgehalten werden. Audiovisuelle Hilfsmittel (wie<br />
z.B. Fotoapparat, Tonband oder Videokamera) können die Prozessabläufe dauerhaft festhalten<br />
und können die Lehrperson während des Unterrichts entlasten. Die Auswertung des<br />
Datenmaterials ist jedoch recht zeitintensiv und erfordert ein ausgearbeitetes Kategoriensystem.<br />
•Zu einem Beobachtungsschwerpunkt einen Beobachtungsbogen entwickeln<br />
•Eine Unterrichtslektion im Hinblick auf eine bestimmte Fragestellung beobachten<br />
• Die eigene Beobachtung mit derjenigen der Praxislehrperson bzw. der Tandempartner/in<br />
vergleichen<br />
• usw.<br />
•Eine Unterrichtslektion im Hinblick auf eine bestimmte Fragestellung beobachten<br />
•Zu einem Beobachtungsschwerpunkt einen Beobachtungsbogen entwickeln<br />
•Die eigenen Beobachtungen einer Unterrichtseinheit mit den Beobachtungen von anderen<br />
vergleichen<br />
• usw.<br />
Beobachtung<br />
Portfolio Erw. Leistungsbeurteilung<br />
Orientierungsarbeiten<br />
Notengebung Lernkontrollen Funktionen<br />
und Normen<br />
Lernberatung Prüfungsangst Fehler Äussere<br />
Differenzierung<br />
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<br />
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy<br />
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<br />
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy<br />
<strong>Bausteinheft</strong> 5, Herbstsemester 11