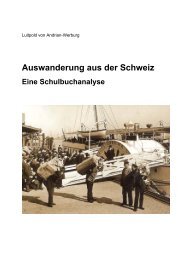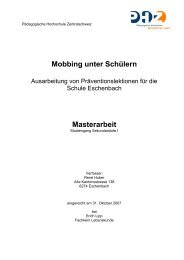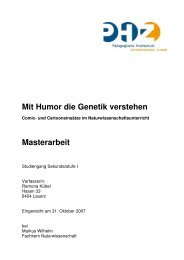Bausteinheft 5 - Sekundarstufe I
Bausteinheft 5 - Sekundarstufe I
Bausteinheft 5 - Sekundarstufe I
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<br />
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy<br />
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<br />
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy<br />
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<br />
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy<br />
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<br />
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy<br />
Präsentation<br />
Lernbericht<br />
Lerntagebuch<br />
Weitere Beurteilungsmöglichkeiten<br />
Eine Präsentation stellt häufig den Abschluss einer selbstständigen Lernphase von Schülerinnen<br />
und Schülern dar und lässt beispielsweise innerhalb eines Projekts eine komplexe<br />
Bewertung zu (siehe oben). Es können unterschiedliche Präsentationsformen vorkommen:<br />
das klassische Referat, eine Buchvorstellung, Lernen durch Lehren, ein Theaterstück,<br />
die Vorstellung von Projektergebnissen, die eigenen Lernziele während einer Unterrichtseinheit<br />
usw. Die Bewertung einer Präsentation bezieht sich auf den Inhalt, auf die Form<br />
und Gestaltung sowie auf die Verbindung zwischen Inhalt und Form und kann mit Hilfe<br />
eines geeigneten Bewertungsbogens sowohl von der Lehrperson als auch vom Plenum oder<br />
den präsentierenden Schülerinnen und Schülern vorgenommen werden. Ein Ziel bei der<br />
Durchführung von Präsentationen im Unterricht besteht in der Entwicklung der Analysefähigkeit,<br />
indem die Schülerinnen und Schüler beispielsweise lernen, eine vordergründig<br />
perfekte und aufwändige Inszenierung kriterienbezogen zu analysieren und die thematische<br />
Tiefe herauszufinden. Neben der Präsentation kann auch der (Gruppen-)Arbeitsprozess<br />
anhand von Bewertungskriterien beurteilt werden (auch hier wiederum durch<br />
Selbst- und Fremdbeurteilung).<br />
Neben neuen Formen des Prüfens haben auch neue Formen der Leistungsbeurteilung<br />
Einzug in den Schulalltag gefunden:<br />
Lernberichte werden häufig am Ende eines Schuljahres, manchmal auch am Ende einer<br />
grösseren Unterrichtseinheit geschrieben. Die Lehrpersonen, die solche Lernberichte über<br />
ihre Schülerinnen und Schüler verfassen, sind geübte Beobachterinnen und Beobachter,<br />
die im Laufe des ganzen Schuljahres Aufzeichnungen über die Lernentwicklung der<br />
Schülerinnen und Schüler machen. Die Texte verbinden fachliche Aspekte mit Beobachtungen<br />
des Arbeits- und Sozialverhaltens der Lernenden. Die Lehrenden teilen ihnen<br />
dadurch mit, was sie an ihrem Lernen beurteilen und in welcher Weise sie das tun. Sie<br />
fügen die Beobachtungen und Fakten so zusammen, dass eine fördernde Diagnose möglich<br />
wird; dabei achten sie auf eine Sprache, die für die Schülerinnen und Schüler (und<br />
ihre Eltern) verstehbar sein muss, die sie anspricht und trotz notwendiger Kritik einen<br />
vertrauensvollen, wertschätzenden und ermutigenden Charakter aufweisen soll. Besonders<br />
in der Sekundarschule, die durch das Fachlehrerprinzip gekennzeichnet ist, ist es erforderlich,<br />
dass sich die in einer Klasse unterrichtenden Lehrpersonen für einen solchen Bericht<br />
absprechen und ihre Beobachtungen kollegial zusammentragen.<br />
Mit Lerntagebüchern werden besondere, eher persönlich gehaltene Formen des Berichtens<br />
über eine Arbeit bzw. einen Unterricht angeregt. In einem eigens dafür vorgesehenen<br />
Heft oder in einer speziellen Spalte im Arbeitsheft können Schülerinnen und Schüler<br />
Beobachtungen, Gelerntes, Gedanken und Gefühle festhalten. Lerntagebücher werden<br />
häufig begleitend zu einer längeren Hausarbeit, einem Unterrichtsabschnitt oder einem ganzen<br />
Kurs geschrieben. Zum Teil werden Lerntagebücher als dialogische Schreibprozesse<br />
organisiert, wenn zum Beispiel die Lehrperson regelmässig Kommentare in das<br />
Lerntagebuch einträgt oder aber die Lernenden reflexiv mit sich in einen inneren Dialog<br />
treten. Die Schülerinnen und Schüler erhalten mit Lerntagebüchern ein Mittel an die Hand,<br />
um eine aktive Haltung zu ihren eigenen Lernprozessen einzunehmen. Das Lerntagebuch<br />
kann selbst ein Leistungsnachweis werden, es kann aber vor allem dazu dienen, dass die<br />
Lehrenden und Lernenden die Hintergründe einer Leistung in den Blick bekommen.<br />
Über die genannten Beurteilungsmöglichkeiten hinaus gibt es noch weitere Formen, die<br />
hier nur erwähnt werden können. In Bewertungskonferenzen etwa können im Vergleich<br />
zu Notenkonferenzen die Lehrenden sich einen direkten Überblick über den Leistungsstand<br />
der Schülerinnen und Schüler (anhand unterschiedlicher Lernprodukte) verschaffen. Des<br />
Weiteren können Zertifikate über erfolgreich absolvierte Projekte oder Kurse vergeben<br />
werden, genannt sei hier das europäische Sprachenportfolio. Anhand eines Lernkontraktes<br />
kann eine Vereinbarung zwischen Lehrpersonen und Lernenden getroffen werden über das,<br />
was gelernt werden soll. Im Mittelpunkt dabei steht die Kontrolle der individuellen<br />
Lernförderung.<br />
Beobachtung<br />
Portfolio Erw. Leistungsbeurteilung<br />
Orientierungsarbeiten<br />
Notengebung Lernkontrollen Funktionen<br />
und Normen<br />
Lernberatung Prüfungsangst Fehler Äussere<br />
Differenzierung<br />
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<br />
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy<br />
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<br />
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy<br />
<strong>Bausteinheft</strong> 5, Herbstsemester 43