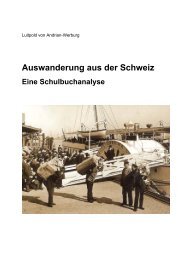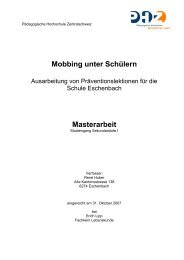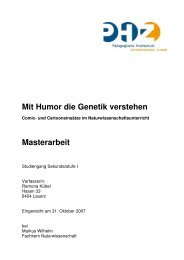Bausteinheft 5 - Sekundarstufe I
Bausteinheft 5 - Sekundarstufe I
Bausteinheft 5 - Sekundarstufe I
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<br />
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy<br />
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<br />
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy<br />
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<br />
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy<br />
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<br />
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy<br />
Beobachtung<br />
Worum geht es?<br />
Beobachten<br />
✘<br />
Beurteilen Bewerten Beraten<br />
Beobachtung<br />
Beschreibung<br />
T. Siegrist, Lehrperson an einer ersten Oberstufe, hat mit ihrer Klasse besprochen, welche<br />
Aufgaben im Rahmen eines mehrwöchigen Projektes zu bearbeiten und welche Leistungen<br />
dabei zu zeigen und zu bewerten sind. Es wird vereinbart, dass am Ende die Präsentation<br />
und das Produkt (ein Lernplakat und eine individuelle Dokumentation) bewertet werden<br />
sollen. Am Präsentationstag beobachtet T. Siegrist die Präsentationen, indem sie einen<br />
gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern entwickelten Beobachtungsbogen verwendet<br />
und beobachtbare Verhaltensweisen während der Präsentation im Beobachtungsbogen<br />
festhält. Die beschriebenen Verhaltensweisen werden anschliessend in einen<br />
Bewertungsmassstab eingeordnet und damit bewertet.<br />
Jede Lehrperson ist im Schulalltag permanent auf Alltagsbeobachtungen angewiesen, um<br />
sich im Klassenzimmer überhaupt orientieren und pädagogisch handeln zu können. Sie<br />
verfügt dabei – auch wenn sie nie an einer speziellen Ausbildung oder einem Training teilgenommen<br />
hat – über eine Reihe von diagnostischen Fertigkeiten des Beobachtens, des<br />
Beurteilens und des Bewertens. Dazu folgendes Beispiel: Ein Lehrer wird im Pausenhof<br />
während eines Gesprächs mit einem Kollegen plötzlich von einem Sekundarschüler angerempelt<br />
und fast umgeworfen. Er reagiert darauf, indem er den vermeintlichen Übeltäter<br />
sofort packt, in anschreit und eine Bestrafung ankündigt. Auf die nachträglich gestellte Frage<br />
seines Kollegen, warum er so heftig reagiert hat und streng war, gibt er folgende Antwort:<br />
«Viele Schüler benehmen sich doch heute auf dem Schulplatz sowieso wie kleine Kinder,<br />
sind rücksichtslos und unaufmerksam. Manche wollen die Lehrer doch nur durch aggressives<br />
Verhalten provozieren – oder? Ausserdem hätte der Schüler mich zu Boden werfen<br />
können. Man darf sich so etwas einfach nicht bieten lassen, weil sonst solche Jugendliche<br />
in ihrem Übermut glauben, sie könnten einem künftig auf dem Kopf rumtanzen.» Es ist sehr<br />
unwahrscheinlich, dass dem Lehrer alle diese (nachträglich geäusserten) Gedanken blitzartig<br />
durch den Kopf schossen, bevor er auf die vermeintliche Provokation reagierte.<br />
Wahrscheinlicher ist es, dass der betroffene Lehrer um seine Autorität fürchtet. Mit Sicherheit<br />
hatte er nicht geprüft, ob der Schüler tatsächlich provozieren wollte oder ob er z.B. lediglich<br />
gestolpert war oder ihn ein anderer Schüler gestossen hatte.<br />
Wir sind im Alltag sehr schnell darin, solche allgemeinen Aussagen zu treffen, ein Urteil<br />
zu fällen, das aber nicht immer gerechtfertigt ist. Die Erfahrung mit Alltagsbeobachtungen<br />
legen uns nahe, dass die Wahrnehmung und das daraus resultierende Urteil mit mehr<br />
oder minder grossen Fehlern behaftet ist. Wahrnehmung ist nie ein Vorgang, bei dem<br />
wir neutral etwas «an sich» wahrnehmen. Unsere Wahrnehmung ist immer durch verschiedene<br />
physische, psychische und soziale Einflüsse gefärbt. Wir strukturieren unsere<br />
Wahrnehmung vor allem nach vier Gesichtspunkten (nach Ingenkamp, 1997):<br />
(1) Selektion. Die Selektion findet statt, wenn wir aus der Fülle der vorhandenen Reize diejenigen<br />
auswählen, die unserer Erwartung und unseren Bedürfnissen entsprechen.<br />
(2) Organisation.Bei der Organisation strukturieren wir die Wahrnehmungsreize so um, dass<br />
sie zu gewissen Persönlichkeitstheorien (oder Annahmen und Vorstellungen) oder Stereotypen,<br />
die wir haben, passen.<br />
(3) Akzentuierung. In der Akzentuierung verleihen wir bestimmten Reizen besonderes<br />
Gewicht, während wir andere unterdrücken.<br />
(4) Fixierung. Durch die Fixierung geben wir einer Tendenz nach, die sich gegen Veränderung<br />
wehrt und einmal gewonnene Eindrücke auch dann auf neue Wahrnehmungsreize<br />
überträgt, wenn sie nicht dazu passen.<br />
Portfolio Erw. Leistungsbeurteilung<br />
Orientierungsarbeiten<br />
Notengebung Lernkontrollen Funktionen<br />
und Normen<br />
Lernberatung Prüfungsangst Fehler Äussere<br />
Differenzierung<br />
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<br />
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy<br />
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<br />
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy<br />
<strong>Bausteinheft</strong> 5, Herbstsemester 7