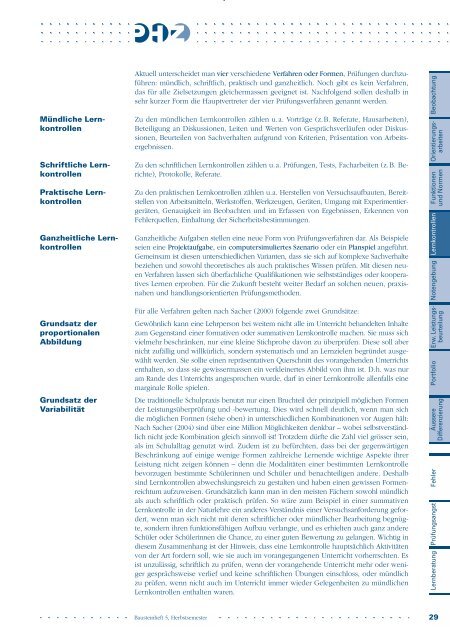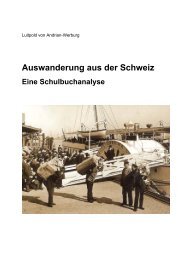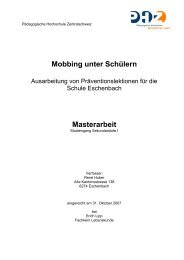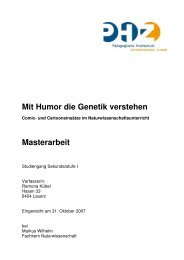Bausteinheft 5 - Sekundarstufe I
Bausteinheft 5 - Sekundarstufe I
Bausteinheft 5 - Sekundarstufe I
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<br />
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy<br />
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<br />
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy<br />
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<br />
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy<br />
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<br />
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy<br />
Mündliche Lernkontrollen<br />
Schriftliche Lernkontrollen<br />
Praktische Lernkontrollen<br />
Ganzheitliche Lernkontrollen<br />
Grundsatz der<br />
proportionalen<br />
Abbildung<br />
Grundsatz der<br />
Variabilität<br />
Aktuell unterscheidet man vier verschiedene Verfahren oder Formen, Prüfungen durchzuführen:<br />
mündlich, schriftlich, praktisch und ganzheitlich. Noch gibt es kein Verfahren,<br />
das für alle Zielsetzungen gleichermassen geeignet ist. Nachfolgend sollen deshalb in<br />
sehr kurzer Form die Hauptvertreter der vier Prüfungsverfahren genannt werden.<br />
Zu den mündlichen Lernkontrollen zählen u.a. Vorträge (z.B. Referate, Hausarbeiten),<br />
Beteiligung an Diskussionen, Leiten und Werten von Gesprächsverläufen oder Diskussionen,<br />
Beurteilen von Sachverhalten aufgrund von Kriterien, Präsentation von Arbeitsergebnissen.<br />
Zu den schriftlichen Lernkontrollen zählen u.a. Prüfungen, Tests, Facharbeiten (z.B. Berichte),<br />
Protokolle, Referate.<br />
Zu den praktischen Lernkontrollen zählen u.a. Herstellen von Versuchsaufbauten, Bereitstellen<br />
von Arbeitsmitteln, Werkstoffen, Werkzeugen, Geräten, Umgang mit Experimentiergeräten,<br />
Genauigkeit im Beobachten und im Erfassen von Ergebnissen, Erkennen von<br />
Fehlerquellen, Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen.<br />
Ganzheitliche Aufgaben stellen eine neue Form von Prüfungsverfahren dar. Als Beispiele<br />
seien eine Projektaufgabe, ein computersimuliertes Szenario oder ein Planspiel angeführt.<br />
Gemeinsam ist diesen unterschiedlichen Varianten, dass sie sich auf komplexe Sachverhalte<br />
beziehen und sowohl theoretisches als auch praktisches Wissen prüfen. Mit diesen neuen<br />
Verfahren lassen sich überfachliche Qualifikationen wie selbstständiges oder kooperatives<br />
Lernen erproben. Für die Zukunft besteht weiter Bedarf an solchen neuen, praxisnahen<br />
und handlungsorientierten Prüfungsmethoden.<br />
Für alle Verfahren gelten nach Sacher (2000) folgende zwei Grundsätze:<br />
Gewöhnlich kann eine Lehrperson bei weitem nicht alle im Unterricht behandelten Inhalte<br />
zum Gegenstand einer formativen oder summativen Lernkontrolle machen. Sie muss sich<br />
vielmehr beschränken, nur eine kleine Stichprobe davon zu überprüfen. Diese soll aber<br />
nicht zufällig und willkürlich, sondern systematisch und an Lernzielen begründet ausgewählt<br />
werden. Sie sollte einen repräsentativen Querschnitt des vorangehenden Unterrichts<br />
enthalten, so dass sie gewissermassen ein verkleinertes Abbild von ihm ist. D.h. was nur<br />
am Rande des Unterrichts angesprochen wurde, darf in einer Lernkontrolle allenfalls eine<br />
marginale Rolle spielen.<br />
Die traditionelle Schulpraxis benutzt nur einen Bruchteil der prinzipiell möglichen Formen<br />
der Leistungsüberprüfung und -bewertung. Dies wird schnell deutlich, wenn man sich<br />
die möglichen Formen (siehe oben) in unterschiedlichen Kombinationen vor Augen hält:<br />
Nach Sacher (2004) sind über eine Million Möglichkeiten denkbar – wobei selbstverständlich<br />
nicht jede Kombination gleich sinnvoll ist! Trotzdem dürfte die Zahl viel grösser sein,<br />
als im Schulalltag genutzt wird. Zudem ist zu befürchten, dass bei der gegenwärtigen<br />
Beschränkung auf einige wenige Formen zahlreiche Lernende wichtige Aspekte ihrer<br />
Leistung nicht zeigen können – denn die Modalitäten einer bestimmten Lernkontrolle<br />
bevorzugen bestimmte Schülerinnen und Schüler und benachteiligen andere. Deshalb<br />
sind Lernkontrollen abwechslungsreich zu gestalten und haben einen gewissen Formenreichtum<br />
aufzuweisen. Grundsätzlich kann man in den meisten Fächern sowohl mündlich<br />
als auch schriftlich oder praktisch prüfen. So wäre zum Beispiel in einer summativen<br />
Lernkontrolle in der Naturlehre ein anderes Verständnis einer Versuchsanforderung gefordert,<br />
wenn man sich nicht mit deren schriftlicher oder mündlicher Bearbeitung begnügte,<br />
sondern ihren funktionsfähigen Aufbau verlangte, und es erhielten auch ganz andere<br />
Schüler oder Schülerinnen die Chance, zu einer guten Bewertung zu gelangen. Wichtig in<br />
diesem Zusammenhang ist der Hinweis, dass eine Lernkontrolle hauptsächlich Aktivitäten<br />
von der Art fordern soll, wie sie auch im vorangegangenen Unterricht vorherrschten. Es<br />
ist unzulässig, schriftlich zu prüfen, wenn der vorangehende Unterricht mehr oder weniger<br />
gesprächsweise verlief und keine schriftlichen Übungen einschloss, oder mündlich<br />
zu prüfen, wenn nicht auch im Unterricht immer wieder Gelegenheiten zu mündlichen<br />
Lernkontrollen enthalten waren.<br />
Beobachtung<br />
Portfolio Erw. Leistungsbeurteilung<br />
Orientierungsarbeiten<br />
Notengebung Lernkontrollen Funktionen<br />
und Normen<br />
Lernberatung Prüfungsangst Fehler Äussere<br />
Differenzierung<br />
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<br />
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy<br />
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<br />
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy<br />
<strong>Bausteinheft</strong> 5, Herbstsemester 29