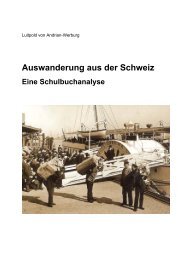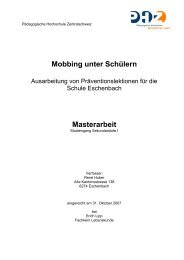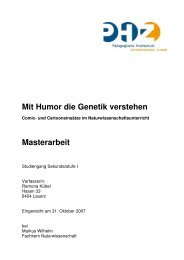Bausteinheft 5 - Sekundarstufe I
Bausteinheft 5 - Sekundarstufe I
Bausteinheft 5 - Sekundarstufe I
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<br />
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy<br />
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<br />
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy<br />
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<br />
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy<br />
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<br />
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy<br />
Selbstbeurteilung<br />
Prozessorientiertes<br />
Prüfen<br />
Die Selbstbeurteilung der Schülerinnen und Schüler ist der zentrale methodische Ansatz<br />
der Leistungsbeurteilung in der Neuen Lernkultur. Ohne Einbeziehung und Kultivierung<br />
der Schülerselbstbeurteilung ist Leistungsbeurteilung in der Neuen Lernkultur letztendlich<br />
gar nicht möglich. Aus rechtlichen und pädagogischen Gründen (Schutz von<br />
Schülerinnen und Schülern vor Benachteiligung) verbleibt die Verantwortung jedoch bei<br />
der Lehrperson.<br />
Ansätze der Beurteilung von Leistungen und Lernprozessen durch die Schüler selbst finden<br />
sich schon in der Reformpädagogik. Dass sich bislang die Schülerselbstbeurteilung<br />
wenig durchgesetzt hat, ist schwer zu verstehen. Denn wir wissen aufgrund aktueller<br />
Erkenntnisse der Neurobiologie und der sich darauf stützenden konstruktivistischen<br />
Ansätze der Unterrichtstheorie: Lernen wird entscheidend durch die Lernsubjekte gestaltet!<br />
Auch die Zielvorgabe des mündigen Menschen, welche diejenige des eigenständigen<br />
Lerners impliziert, beinhaltet drei Elemente: Kontrolle des eigenen (Lern-)Verhaltens,<br />
Kontrolle der Umgebung und Selbstbeobachtung. Zum selbstständigen und selbst gesteuerten<br />
Lernen gehört also zweifellos auch die Selbstbeurteilung des Lern- und Leistungsprozesses<br />
und seiner Ergebnisse durch die Schülerinnen und Schüler. Wichtig: Selbstbeurteilung<br />
im Sinne des Reflektierens und Kommunizierens über Lernprozesse und<br />
Leistungen liegt auch vor, wo Schülerinnen und Schüler über Leistungen von Mitschülerinnen<br />
und Mitschülern oder Lehrpersonen urteilen.<br />
Wie kann zur Selbstbeurteilung angeleitet werden? Dazu folgende drei Überlegungen:<br />
1. Die Lernenden haben bereits früher Erfahrungen mit Methoden der Selbstbeurteilung<br />
gesammelt. Für den Unterricht auf der <strong>Sekundarstufe</strong> I gilt, die Lernerfahrungen sorgfältig<br />
zu analysieren und bei der Unterrichtsvorbereitung zu berücksichtigen. So erhalten<br />
die Schülerinnen und Schüler bereits im Kindergarten und vor allem in den ersten<br />
zwei Jahren der Primarschule Gelegenheit, ihre Lernleistungen zu beurteilen (GBF:<br />
Ganzheitlich Beurteilen und Fördern). Aber auch für das Übertrittsverfahren von der<br />
Primarschule in die Sekundarschule sind viele Selbstbeobachtungsbögen im Einsatz.<br />
2. Die Beobachtungs- bzw. Beurteilungspunkte sollen gemeinsam entwickelt werden. Es<br />
werden offene (z.B. Lernjournal, Lerntagebuch – siehe unten) und geschlossene<br />
Verfahren (z.B. Frage- und Beurteilungsbögen) zur Selbstbeurteilung eingesetzt. Ein<br />
schrittweises Heranführen der Lernenden an die Selbstbeurteilung ist wichtig. In einer<br />
ersten Phase kann eine Fremdbeurteilung des Lernpartners Ausgangspunkt zur Selbstbeurteilung<br />
sein. Die Rückmeldung des Lernpartners ermöglicht, die eigene Leistung kritisch<br />
zu hinterfragen und eigene Erkenntnisse daraus abzuleiten. Eine genaue Umschreibung<br />
der Beurteilungspunkte (Kriterien) ist wichtig.<br />
3. In einer zeitgemässen Lehr- und Lernkultur, welche einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt<br />
(siehe Erläuterungen im Kapitel «Einführung in das Semesterthema»), ist eine<br />
Rückmeldung der Lehrperson, des Lernpartners oder der Klasse ein zentrales Element.<br />
Die Schülermitbewertung fordert die Lernenden zum Rollenwechsel (vgl. Einführungsbeispiel).<br />
Es hat sich als sinnvoll erwiesen, zu Beginn arbeitsteilig vorzugehen, zum<br />
Beispiel bei der Bewertung einer Präsentation: Gruppenweise übernehmen Schülerinnen<br />
und Schüler ein oder mehrere Beurteilungskriterien und besprechen ihre Ergebnisse<br />
anschliessend in dieser «Fachgruppe», bevor Bewertungen klassenöffentlich werden.<br />
Dadurch wird eine Überforderung vermieden, unterschiedliche Wahrnehmungen können<br />
angeglichen werden.<br />
Ein konkreter Ansatz dazu sind anwendungs- bzw. prozessorientierte Prüfungsformen.<br />
Charakteristisch dabei ist, dass sich die Lernenden gedanklich und konkret mit Situationen<br />
auseinander setzen, die nachvollziehbar mit dem wirklichen Tun und Leben «ausserhalb<br />
der Schulstube» zu tun haben. Prozesshaft werden bestimmte Fälle gelöst oder man muss<br />
sich mit komplexen Problemen auseinander setzen, Lösungen finden und anwenden.<br />
Dabei sollen die Lernenden ein Produkt erstellen und dokumentieren, zum Beispiel in<br />
einem Themendossier, in einer Facharbeit oder in einer Projektdokumentation (vgl. dazu<br />
Beobachtung<br />
Portfolio Erw. Leistungsbeurteilung<br />
Orientierungsarbeiten<br />
Notengebung Lernkontrollen Funktionen<br />
und Normen<br />
Lernberatung Prüfungsangst Fehler Äussere<br />
Differenzierung<br />
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<br />
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy<br />
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<br />
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy<br />
<strong>Bausteinheft</strong> 5, Herbstsemester 41