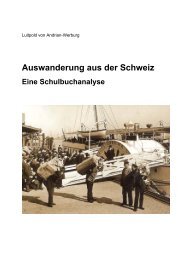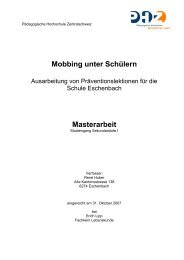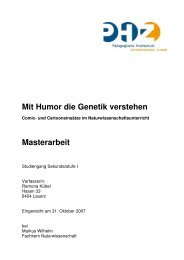Bausteinheft 5 - Sekundarstufe I
Bausteinheft 5 - Sekundarstufe I
Bausteinheft 5 - Sekundarstufe I
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<br />
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy<br />
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<br />
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy<br />
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<br />
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy<br />
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<br />
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy<br />
Anlegen einer<br />
Benotungsskala<br />
Intuitive Methoden<br />
Rationale Methoden<br />
Betrachtet man die Schulnote von ihrer (möglichen) Funktion her als eine Masszahl für<br />
einen Leistungsstand, als Mittel der Rückmeldung eines Lernstandes, als Entscheidungsgrundlage<br />
für die Auslese usw. (vgl. Baustein «Funktionen und Normen»), so erscheint<br />
die Bezeichnung «Generalindikator» angemessen. Es ist plausibel und einsichtig, dass ein<br />
einziges Verfahren nicht all die oben aufgelisteten Funktionen gut erfüllen kann. Darüber<br />
hinaus sollen die Noten noch ein Machtmittel in der Hand der Lehrperson sein, als Anreiz<br />
zum Lernen dienen usw.<br />
Die Forschung zur Prüfungs- und Notenpraxis zeigt deutlich, dass der Generalindikator<br />
Schulnote zu wenig pädagogisch relevante Informationen enthält: Schulnoten erfüllen<br />
die meisten Funktionen der Leistungsbewertung nur scheinbar. Die Untersuchungen<br />
machen darüber hinaus Folgendes deutlich:<br />
•Schlechte Validität: Es ist oft unklar, was eine 3 oder eine 5 in Französisch, Geschichte<br />
oder Mathematik inhaltlich bedeutet, was ein Lernender, eine Schülerin wirklich kann<br />
und was nicht. Analysen über das Zustandekommen von Noten belegen, dass eine für<br />
Aussenstehende unbekannte Zahl von Faktoren in die Note einfliesst.<br />
•Schlechte Objektivität: Die unabhängige Nachkontrolle ergibt sogar bei Mathematikprüfungen<br />
eine Differenz von zwei bis drei Notenpunkten. Bei gleichen Leistungen<br />
erzielen Knaben und Mädchen, Schüchterne und Selbstbewusste, Einheimische und<br />
Ausländer usw. chronisch unterschiedliche Noten.<br />
•Schlechte Reliabilität: Die Wiederholungszuverlässigkeit bei «hausgemachten», also nicht<br />
aufgrund von Kompetenzmodellen erstellten Prüfungen ist mässig bis schlecht. Prüfungswiederholungen<br />
führen regelmässig zu viel schlechteren Resultaten.<br />
•Schlechte Vergleichbarkeit: Häufig ist eine Vergleichbarkeit von Noten innerhalb derselben<br />
Schule nicht gegeben: Eine 4 bei Lehrer X entspricht einer 3 oder einer 5 bei<br />
Parallelklassen-Lehrerin Y.<br />
Für das Anlegen der Benotungsskala hat die Lehrperson bei der Umrechnung von Anzahl<br />
von Rohpunkten bzw. Fehlern in eine der sechs Notenstufen eine bestimmte Bezugsnorm<br />
zugrunde zu legen (vgl. Baustein «Funktionen und Bezugsnormen»). Wenn ein Schüler<br />
beispielsweise von einer Lehrerin für seine Mathematikarbeit 22 Punkte zugesprochen<br />
bekommt, lässt sich seine Leistung nicht bewerten, wenn nicht weitere Informationen<br />
gegeben sind, also etwa Aussagen über die unterste Punktegrenze oder über die Werte,<br />
die andere Schülerinnen und Schüler der Klasse erreicht haben.<br />
Bei der Notengebung im Schulalltag sind folgende zwei Arten des Vorgehens üblich:<br />
• Intuitive Methoden<br />
•Rationale Methoden<br />
Diese Methoden basieren auf der Vorstellung, dass mit Hilfe von Beobachtungen eine<br />
gezeigte Leistung gewissermassen «aus dem Bauch heraus» bewertet werden kann. Intuitive<br />
Methoden der Beurteilung sind gekennzeichnet durch ein eher unstrukturiertes Vorgehen.<br />
Angesichts der Ansprüche an eine zeitgemässe Beurteilungspraxis (siehe Kapitel «Einführung<br />
in das Semesterthema») ist ein solches Vorgehen eher problematisch.<br />
Die sachliche Norm (Lernzielnorm) bildet prinzipiell den Kern von rationalen Methoden<br />
der schulischen Leistungsbewertung, die bemüht ist zu prüfen, inwieweit Lehrplanziele<br />
erreicht werden. Praktisch dürfte aber die Sozialnorm in den Schulstuben eine viel grössere<br />
Bedeutung haben. Die konsequente Umsetzung der Sozialnorm ist die Anwendung<br />
von Quotenmodellen der Benotung, wie sie aus der Testtheorie übertragen werden können.<br />
So orientieren sich viele Lehrpersonen bei ihrer Notenverteilung an Berechnungsmodellen,<br />
denen mehr oder weniger das Konzept der Normalverteilung (Gauss-Kurve)<br />
zugrunde gelegt wird: Die Leistungen einer Gruppe verteilen sich dann in Form einer<br />
Glocke um einen Mittelwert, die Mehrheit erbringt mittlere Leistungen, wenige Schülerinnen<br />
und Schüler ganz gute oder ganz schlechte. In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu<br />
wissen, wie der Mathematiker Gauss das Normalverteilungsgesetz entdeckte: nämlich<br />
beim Qualitätssortieren von Getreidekörnern aus unbehandelten, gewissermassen natur-<br />
Beobachtung<br />
Portfolio Erw. Leistungsbeurteilung<br />
Orientierungsarbeiten<br />
Notengebung Lernkontrollen Funktionen<br />
und Normen<br />
Lernberatung Prüfungsangst Fehler Äussere<br />
Differenzierung<br />
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<br />
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy<br />
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<br />
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy<br />
<strong>Bausteinheft</strong> 5, Herbstsemester 35