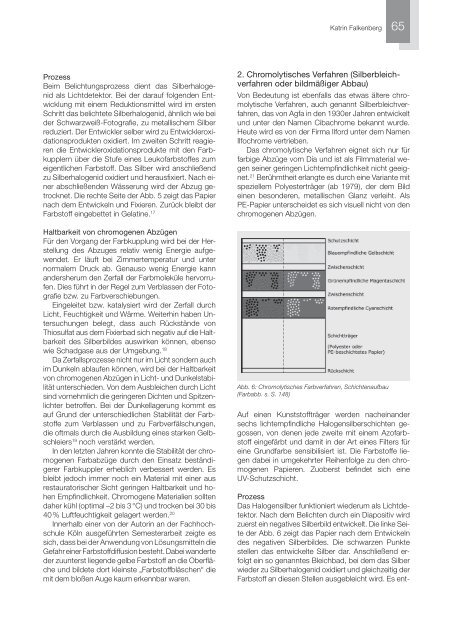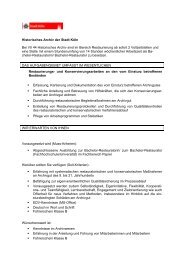11 / 2007 - Arbeitskreis Nordrhein-Westfälischer ...
11 / 2007 - Arbeitskreis Nordrhein-Westfälischer ...
11 / 2007 - Arbeitskreis Nordrhein-Westfälischer ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Katrin Falkenberg<br />
65<br />
Prozess<br />
Beim Belichtungsprozess dient das Silberhalogenid<br />
als Lichtdetektor. Bei der darauf folgenden Entwicklung<br />
mit einem Reduktionsmittel wird im ersten<br />
Schritt das belichtete Silberhalogenid, ähnlich wie bei<br />
der Schwarzweiß-Fotografi e, zu metallischem Silber<br />
reduziert. Der Entwickler selber wird zu Entwickleroxidationsprodukten<br />
oxidiert. Im zweiten Schritt reagieren<br />
die Entwickleroxidationsprodukte mit den Farbkupplern<br />
über die Stufe eines Leukofarbstoffes zum<br />
eigentlichen Farbstoff. Das Silber wird anschließend<br />
zu Silberhalogenid oxidiert und herausfi xiert. Nach einer<br />
abschließenden Wässerung wird der Abzug getrocknet.<br />
Die rechte Seite der Abb. 5 zeigt das Papier<br />
nach dem Entwickeln und Fixieren. Zurück bleibt der<br />
Farbstoff eingebettet in Gelatine. 17<br />
Haltbarkeit von chromogenen Abzügen<br />
Für den Vorgang der Farbkupplung wird bei der Herstellung<br />
des Abzuges relativ wenig Energie aufgewendet.<br />
Er läuft bei Zimmertemperatur und unter<br />
normalem Druck ab. Genauso wenig Energie kann<br />
andersherum den Zerfall der Farbmoleküle hervorrufen.<br />
Dies führt in der Regel zum Verblassen der Fotografi<br />
e bzw. zu Farbverschiebungen.<br />
Eingeleitet bzw. katalysiert wird der Zerfall durch<br />
Licht, Feuchtigkeit und Wärme. Weiterhin haben Untersuchungen<br />
belegt, dass auch Rückstände von<br />
Thiosulfat aus dem Fixierbad sich negativ auf die Haltbarkeit<br />
des Silberbildes auswirken können, ebenso<br />
wie Schadgase aus der Umgebung. 18<br />
Da Zerfallsprozesse nicht nur im Licht sondern auch<br />
im Dunkeln ablaufen können, wird bei der Haltbarkeit<br />
von chromogenen Abzügen in Licht- und Dunkelstabilität<br />
unterschieden. Von dem Ausbleichen durch Licht<br />
sind vornehmlich die geringeren Dichten und Spitzenlichter<br />
betroffen. Bei der Dunkellagerung kommt es<br />
auf Grund der unterschiedlichen Stabilität der Farbstoffe<br />
zum Verblassen und zu Farbverfälschungen,<br />
die oftmals durch die Ausbildung eines starken Gelbschleiers<br />
19 noch verstärkt werden.<br />
In den letzten Jahren konnte die Stabilität der chromogenen<br />
Farbabzüge durch den Einsatz beständigerer<br />
Farbkuppler erheblich verbessert werden. Es<br />
bleibt jedoch immer noch ein Material mit einer aus<br />
restauratorischer Sicht geringen Haltbarkeit und hohen<br />
Empfi ndlichkeit. Chromogene Materialien sollten<br />
daher kühl (optimal –2 bis 3 °C) und trocken bei 30 bis<br />
40 % Luftfeuchtigkeit gelagert werden. 20<br />
Innerhalb einer von der Autorin an der Fachhochschule<br />
Köln ausgeführten Semesterarbeit zeigte es<br />
sich, dass bei der Anwendung von Lösungsmitteln die<br />
Gefahr einer Farbstoffdiffusion besteht. Dabei wanderte<br />
der zuunterst liegende gelbe Farbstoff an die Oberfl ä-<br />
che und bildete dort kleinste „Farbstoffbläschen“ die<br />
mit dem bloßen Auge kaum erkennbar waren.<br />
2. Chromolytisches Verfahren (Silberbleichverfahren<br />
oder bildmäßiger Abbau)<br />
Von Bedeutung ist ebenfalls das etwas ältere chromolytische<br />
Verfahren, auch genannt Silberbleichverfahren,<br />
das von Agfa in den 1930er Jahren entwickelt<br />
und unter den Namen Cibachrome bekannt wurde.<br />
Heute wird es von der Firma Ilford unter dem Namen<br />
Ilfochrome vertrieben.<br />
Das chromolytische Verfahren eignet sich nur für<br />
farbige Abzüge vom Dia und ist als Filmmaterial wegen<br />
seiner geringen Lichtempfi ndlichkeit nicht geeignet.<br />
21 Berühmtheit erlangte es durch eine Variante mit<br />
speziellem Polyesterträger (ab 1979), der dem Bild<br />
einen besonderen, metallischen Glanz verleiht. Als<br />
PE-Papier unterscheidet es sich visuell nicht von den<br />
chromogenen Abzügen.<br />
Abb. 6: Chromolytisches Farbverfahren, Schichtenaufbau<br />
(Farbabb. s. S. 148)<br />
Auf einen Kunststoffträger werden nacheinander<br />
sechs lichtempfi ndliche Halogensilberschichten gegossen,<br />
von denen jede zweite mit einem Azofarbstoff<br />
eingefärbt und damit in der Art eines Filters für<br />
eine Grundfarbe sensibilisiert ist. Die Farbstoffe liegen<br />
dabei in umgekehrter Reihenfolge zu den chromogenen<br />
Papieren. Zuoberst befi ndet sich eine<br />
UV-Schutzschicht.<br />
Prozess<br />
Das Halogensilber funktioniert wiederum als Lichtdetektor.<br />
Nach dem Belichten durch ein Diapositiv wird<br />
zuerst ein negatives Silberbild entwickelt. Die linke Seite<br />
der Abb. 6 zeigt das Papier nach dem Entwickeln<br />
des negativen Silberbildes. Die schwarzen Punkte<br />
stellen das entwickelte Silber dar. Anschließend erfolgt<br />
ein so genanntes Bleichbad, bei dem das Silber<br />
wieder zu Silberhalogenid oxidiert und gleichzeitig der<br />
Farbstoff an diesen Stellen ausgebleicht wird. Es ent-<br />
papierrestauratoren - endfassung65 65 31.01.2008 14:04:<strong>11</strong>