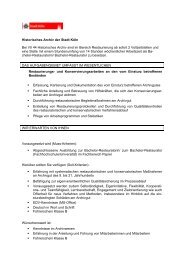11 / 2007 - Arbeitskreis Nordrhein-Westfälischer ...
11 / 2007 - Arbeitskreis Nordrhein-Westfälischer ...
11 / 2007 - Arbeitskreis Nordrhein-Westfälischer ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Bert Ja ek<br />
91<br />
partners noch länger in den Materialien verbleiben.<br />
Dabei können sie Radikalnester bilden und schädigende<br />
Alterungsreaktionen induzieren (Microspots)<br />
und beschleunigen.<br />
Bei sterilisierten Büchern (Bestrahlungen zwischen<br />
1998 und 2002) wurde wieder ein frischer Befall mit<br />
Schimmelpilzen entdeckt, was ein Beweis dafür ist,<br />
dass letztlich nach einer Schimmelpilzbehandlung<br />
das Hauptaugenmerk immer auf eine konservatorische<br />
Lagerung zu richten ist. Ebenfalls verlieren Barytabzüge<br />
bis zu einem Viertel ihrer Bruchfestigkeit,<br />
wie in Tests nachgewiesen wurde 28 . Auch wenn die<br />
Fotografi en unter normalen Bedingungen nicht mechanisch<br />
strapaziert werden, wird deren Lebensdauer<br />
durch eventuell mehrmalige Behandlungen erheblich<br />
verkürzt.<br />
Desinfektion mit Alkoholen 29<br />
Die mikrobiozide Wirkung von Alkoholen ist schon lange<br />
bekannt. Sie wirken sehr schnell, sind einfach anzuwenden,<br />
haben ein breites Wirkungsspektrum und<br />
benötigen keinen großen apparativen Aufwand (Absaugmöglichkeit<br />
für die Dämpfe schaffen).<br />
Von den aliphatischen 30 Alkoholen sind die mit 2<br />
bis 8 C-Atomen die wirksamsten. Obwohl die mit 5–8<br />
C-Atomen am effektivsten sind, haben sich nur Ethanol<br />
(2 C-Atome) und die Propanole (3 C-Atome) in<br />
der Restaurierungspraxis durchgesetzt. Die längerkettigen<br />
Alkohole weisen zu lange Verdunstungszeiten<br />
auf, haben einen unangenehmen Geruch und können<br />
schnell über die Haut (respektive Schleimhäute) gesundheitsschädigend<br />
aufgenommen werden 31 . Prinzipiell<br />
wirken die Alkohole durch das Denaturieren der<br />
Eiweißstrukturen in den lebenden Pilzteilen. Des weiteren<br />
wird die Eiweiß- und die Zellwandsynthese behindert.<br />
Auch fi ndet die Blockierung des Stoffwechsels<br />
durch falsche Reaktionspartner statt.<br />
Wichtig beim Einsatz von Alkoholen ist jedoch,<br />
dass diese nicht zu hochprozentig verwendet werden.<br />
Die Zellwände verfügen über Mechanismen zum Verschließen<br />
ihrer Öffnungen, wodurch das Eindringen<br />
des Alkohols blockiert wird. Die Ansichten über eine<br />
sporizide Wirkung gehen auseinander. Da die Sporen<br />
ohnehin weitestgehend abgenommen werden müssen,<br />
ist dieser Aspekt nicht so relevant.<br />
Bei feuchtem Gut setzt eine mikrobiozide Wirkung<br />
schon ab 30 %iger Konzentration von Ethanol ein,<br />
bei trockenem Gut sind 60–70 % Ethanol in Wasser<br />
am effektivsten. Allerdings muss darauf hingewiesen<br />
werden, dass eigentlich das Abwischen der Oberfl<br />
äche mit dieser Lösung nicht für eine Desinfektion<br />
ausreicht! Soll tatsächlich eine Desinfektion erfolgen,<br />
müssen die Fotografi en mindestens 90 sec mit einem<br />
80 %igen Ethanol-Wasser-Gemisch benetzt sein 32 . Allerdings<br />
werden bei einer „Reinigung mit einem Desinfektionsmittel“<br />
die aufl iegenden Hyphen und Sporen<br />
abgenommen, was ausreicht, wenn die Fotografi en<br />
danach trocken genug gelagert werden.<br />
Besser geeignet als Ethanol sind n-Propanol und<br />
Isopropanol (2-Propanol), wobei zweiteres mikrobiell<br />
am wirksamsten ist. Beide Propanole wirken bei<br />
60–70 %iger Konzentration und zweimaliger Anwendung<br />
von 2,5 min mit einer Abtötungsrate um 98 % 33 .<br />
Sie haben auch den Vorteil, dass sie langsamer als<br />
Ethanol verdunsten und dadurch die Einwirkzeit länger<br />
ist. Bei einer kurzen Behandlungsdauer wird nur<br />
das Luftmycel desinfi ziert. Über die „Tiefenwirkung“<br />
bis ins Substratmycel konnten keine Angaben gefunden<br />
werden.<br />
Zu berücksichtigen ist bei der Verwendung alkoholischer<br />
Lösungen, dass ein gewisser Wasseranteil<br />
bspw. in die Gelatine eingebracht wird. Wie empfi ndlich<br />
eine Oberfl äche auf die Feuchtigkeit und das „Reiben“<br />
reagiert, muss an einer unauffälligen Stelle zuvor<br />
getestet werden. Möglich sind auch der Einsatz<br />
von Klimakammern oder Aerosolgeräten, die die Objekte<br />
mit der Desinfektionslösung bedampfen 34 . Eine<br />
zu hohe Konzentration des Alkohols (über 90 %) sollte<br />
vermieden werden, da dies zum Austrocknen von Gelatine<br />
und so zu Abplatzungen und Rissen führen kann.<br />
Weiterhin verdunstet dieses Gemisch sehr schnell und<br />
die Verdunstungskälte kann zu Spannungen, z. B. bei<br />
Glasplatten, führen 35 . Negative Auswirkungen durch<br />
die Retentionszeiten der Lösungsmittel wurden noch<br />
nicht beobachtet 36 . Die alkoholische Desinfektion von<br />
Kollodium- oder Firnisschichten ist durch deren Lösungsverhalten<br />
ausgeschlossen.<br />
Die Anwendung von Desinfektionsbädern ist nur<br />
nach einer vorigen Härtung der Gelatine denkbar, damit<br />
eventuell abgebaute Gelatine nicht verloren geht.<br />
Mit einer Härtung durch Formaldehyddämpfe geht<br />
eine gleichzeitige, ausreichende Sterilisierung der Mikroorganismen<br />
einher.<br />
Teilsterilisation durch Vakuumierung<br />
Es gibt sehr gute Erfahrungen beim Einsatz dieses<br />
Verfahrens in Bibliotheken und Archiven, dennoch wird<br />
die Praxis der Vakuumierung noch recht selten angewandt.<br />
Dabei können mit ihr sehr bequem zwei Ziele<br />
erreicht werden: sowohl die Trocknung der Objekte,<br />
als auch die Abtötung aller lebenden Mikroorganismen<br />
und –teile (einschließlich des Substratmyceles) 37 .<br />
Mit dem Evakuieren der Luft dehnt sich das Zellplasma<br />
der Hyphen aus und bringt die Zellen zum<br />
Platzen. Dafür muss allerdings ein recht hohes Vakuum<br />
angelegt werden. Dies funktioniert nicht bei bereits<br />
eingefrorenem Gut: Viele Mikroorganismen sind<br />
dann zwar inaktiv, können aber unter günstigen Lebensbedingungen<br />
wieder vital werden. In der Vakuumkammer<br />
entstehen bei einer schnellen Evakuierung<br />
unter 0,26 mbar schockartig Temperaturen von bis<br />
zu – 23 °C, was für Kollodiummaterialien und gefi r-<br />
papierrestauratoren - endfassung91 91 31.01.2008 14:04:33