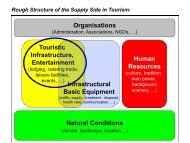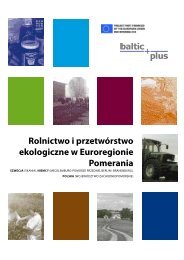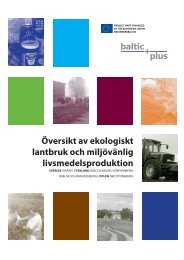umweltrechtliche Belange - Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
umweltrechtliche Belange - Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
umweltrechtliche Belange - Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Aktuelle Rechtsprechung des OVG Mecklenburg-Vorpommern zum Baugesetzbuch<br />
mer nach § 8 Abs. 2 SchuldRAnpG in die zwischen den örtlichen Räten und den ehemaligen Kreis- oder<br />
Ortsverbänden des VKSK abgeschlossenen (Zwischenpacht-) Verträge eingetreten25 . Nach § 2 Abs. 3 S. 2<br />
SchuldRAnpG wäre aber dieses Gesetz vom dem Zeitpunkt an nicht anzuwenden, zu dem das Grundstück<br />
in eine Kleingartenanlage wegen § 1 Abs. 3 BKleingG erst eingegliedert wird. Auch die Möglichkeit<br />
einer Kündigung des Pachtvertrags würden sich nunmehr nach § 9 BKleingG bestimmen, nicht<br />
mehr nach dem Schuldrechtsanpassungsgesetz. Die Möglichkeiten der Nutzung und Verwertung der<br />
Kleingärten durch die Eigentümer wären dann aufgrund der kleingartenrechtlichen Vorschriften erheblich<br />
eingeschränkt. Das bedingt zugleich Vor- oder Nachteile für die Pächter. So dürfen z.B. Pachtverträge<br />
über Kleingärten nur auf unbestimmte Zeit abgeschlossen werden, der höchstzulässige Pachtzins ist<br />
gesetzlich geregelt und die Kündigung der Pachtverträge ist erheblich erschwert (§§ 5, 6 und 9<br />
BKleingG). Baulich zulässig ist grundsätzlich nur die Errichtung von Anlagen, die der Kleingartennutzung<br />
dienen, wie Lauben, die nicht zum dauernden Wohnen geeignet sind, Einfriedungen und Gemeinschaftseinrichtungen;<br />
ob dies aus der Sicht der Pächter ein Vor- oder Nachteil ist, kann hier dahinstehen.<br />
Wenn also die Fläche in rechtlicher Hinsicht gem. § 20 a BKleingG nicht als Kleingarten zu werten ist,<br />
würden durch die Festsetzungen des Bebauungsplans diese Rechtswirkungen konstitutiv eintreten.<br />
Wenn die Fläche bereits nach § 20 a BKleingG dem Regime dieses Gesetzes unterfallen sollte, würde<br />
sich der Status gem. § 1 Abs. 3 BKleingG in einen Dauerkleingarten umwandeln. Rechtsfolge wäre dann<br />
hinsichtlich der vertraglichen Verhältnisse mit dem Verpächter, dass die Kündigung nach § 9 Abs. 1 Nr.<br />
3 und 4 gem. Abs. 3 BKleingG zulässig werden. Diese Folge würde allerdings der Bebauungsplan nicht<br />
ursächlich auslösen, da schon der übergeleitete Nutzungsvertrag unbestimmte Zeit galt, wie es nach<br />
DDR-Recht die Regel war26 . Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans würden diese Rechtswirkungen<br />
aber verfestigt.<br />
Auswirkungen hat der Bebauungsplan in jedem Falle auch für diejenigen Pächter, die bereits - wie das<br />
Bürderschaftsmitglied L. - mit einem auf unbestimmte Zeit geltenden Pachtvertrag ausgestattet sind. Sie<br />
betreffen die mögliche bauliche Nutzbarkeit: Der Bebauungsplan kann unbeschadet der in § 3 BKleingG<br />
vorgesehenen Beschränkungen weitere Regelungen der baulichen Nutzbarkeit festsetzen. Dies ist hier<br />
durchgehend für alle Parzellen hinsichtlich der bebaubaren Fläche durch Baugrenzen nach § 9 Abs. 1 Nr.<br />
2 BauGB geschehen. Wegen der durch das Bundeskleingartengesetz vermittelten Rechtsstellung des<br />
Pächters ist dieser hinsichtlich der baulichen Nutzbarkeit des Kleingartengrundstücks dem Eigentümer<br />
einer sonstigen Fläche qualitativ in Hinblick auf das Mitwirkungsverbot gleichzustellen27 .<br />
Die Mitwirkungsverbote des Absatzes 1 gelten nach § 24 Abs. 2 KV M-V nicht, (1.) wenn der Vorteil oder<br />
der Nachteil nur darauf beruht, dass jemand einer Berufs- oder Bevölkerungsgruppe angehört, deren<br />
gemeinsame Interessen durch die Angelegenheit berührt werden, (2.) bei Wahlen sowie bei Abberufungen,<br />
und (3.) wenn die Vertretung der natürlichen oder juristischen Person oder Vereinigung auf Vorschlag<br />
der Gemeinde ausgeübt wird. Diese Regelungen greifen erkennbar nicht ein. Von einem Bebauungsplan<br />
betroffene Grundstückseigentümer bilden namentlich keine Bevölkerungsgruppe mit gemeinsamen<br />
Interessen im Sinne dieser Vorschrift. Ihre Interessen sind jeweils auf die persönlichen Verhältnisse<br />
und die Verhältnisse ihrer Grundstücke abgestellt28 . Gleiches gilt hier für die Gruppe der Kleingärtner<br />
als betroffene Pächter, selbst wenn sie eine große Anzahl ausmachen.<br />
25 OLG Dresden, U. v. 21.02.2003 - 21 U 1948/02 - ZOV 2003, 180 = VIZ 2003, 491<br />
26 vgl.5.nczyk, Bundeskleingartengesetz, 8. Aufl. § 20 a Rn. 10<br />
27 vgl. zu diesem Grundsatz Menke, Das kommunale Mitwirkungsverbot bei der Bauleitplanung, 1990 S. 132 ff.<br />
28 VGH Mannheim, B. v. 01.07.1991 - 8 S 1712/90 - NVwZ-RR 1992, 538<br />
38