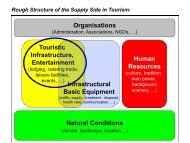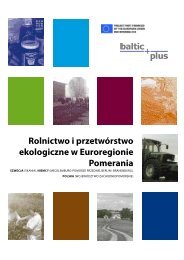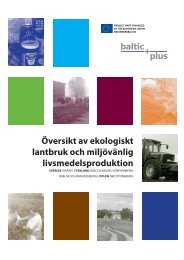umweltrechtliche Belange - Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
umweltrechtliche Belange - Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
umweltrechtliche Belange - Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Baurecht auf Zeit und Planungsschadensrecht<br />
der Markt bei der Bestimmung dessen hat, was dem Grundstückseigentümer an Rechten zusteht – sei<br />
es an Befugnissen an seinem Grundstück, einschließlich dem Recht, es zu bebauen, sei es an Entschädigungsansprüchen.<br />
II Das subjektive Baurecht als Anspruch gegen den Staat<br />
Das sog. „Baurecht auf Zeit“ hat letztlich genau den Zweck, Entschädigungsansprüche des Grundeigentümers<br />
gegen die Gemeinde bei sog. Planungsschäden auszuschließen bzw. solche Ansprüche gar<br />
nicht erst entstehen zu lassen. Dabei ist die Bezeichnung „Baurecht auf Zeit“ für den Laien zunächst<br />
missverständlich, denn gemeint ist mit „Baurecht“ nicht das objektive Baurecht, also etwa ein Baugesetzbuch<br />
mit Verfalldatum, sondern das subjektive Recht des Eigentümers, sein Grundstück zu<br />
bebauen. Beim Baurecht im subjektiven Sinn geht es mithin um einen Anspruch, einen Anspruch gegen<br />
– ja, wen? wohl gegen den Staat.<br />
Nach der h.M. im deutschen öffentlichen Recht hat der Grundstückseigentümer, wenn öffentlichrechtliche<br />
Vorschriften nicht entgegenstehen, das Recht, ja die „Freiheit“ – Baufreiheit –, es nach seinem<br />
Belieben zu bebauen3 . Defensiver formuliert: Der Grundeigentümer hat gegenüber dem Staat ein<br />
Recht, sein Grundstück im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zu bebauen4 . Nicht etwa hat der<br />
Staat ein Ermessen, wem er „Baurechte“ zuteilt. So viel Obrigkeit soll denn doch nicht sein.<br />
Erstaunlicherweise ist nun aber das Zentraldogma, das hinter der Frage steht, inwieweit ein Baurecht<br />
auf Zeit zulässig ist, in gewisser Weise obrigkeitlich geprägt. Das Dogma lautet: Was der Eigentümer<br />
einmal an subjektivem Baurecht erworben hat, das darf ihm der Staat nicht wieder entziehen, es sei<br />
denn, er gewährt dafür Entschädigung. Das subjektive Baurecht besteht grundsätzlich unbefristet und<br />
unbedingt, auf ewig5 . Dies gilt auch dann, wenn der Staat, die Obrigkeit, dieses Baurecht aktiv geschaffen<br />
hat, z.B. durch einen Bebauungsplan, der das Grundstück vom Ackerland zum Bauland aufwertet<br />
und dadurch den Eigentümer in den Genuss einer erheblichen Wertsteigerung kommen lässt.<br />
Diesen Wert darf ihm derselbe Staat nicht durch eine neue Planung entziehen. Widerstand gegen die<br />
Obrigkeit zeigt sich in Deutschland offenbar gern in Anspruchsdenken.<br />
III Wertsicherung durch das sog. Planungsschadensrecht<br />
1. Die einfachrechtliche Ausgestaltung (§§ 39–44 BauGB)<br />
Im einfachen Recht hat dieses Anspruchsdenken Ausdruck im sog. Planungsschadensrecht6 gefunden,<br />
§§ 39–44 BauGB. Der Name ist Programm: Wenn eine staatliche Planung dazu führt, dass ein Grundstück<br />
nach der Planung weniger wert ist als vorher, dann wird dies als ein Schaden definiert, für den<br />
der Staat einzustehen hat. Es gilt also nicht etwa das Hiob-Prinzip: Der Staat hat das Baurecht gegeben,<br />
der Staat hat’s genommen, gelobet sei der Staat. Vielmehr findet das Schäfchen-im-Trockenen-<br />
3 Genauer unten bei und in Fußn. 21, 22.<br />
4 BVerfGE 104, 1 (11) – Baulandumlegung –; entgegen Schieferdecker, BauR 2005, 320 (328), spricht die Formulierung<br />
gerade nicht für eine darüber hinausgehende „Baufreiheit“.<br />
5 Dies gilt unabhängig davon, dass die Baugenehmigung gem. den Landesbauordnungen üblicherweise eine<br />
Geltungsdauer von drei Jahren hat (z.B. § 74 LBauO M-V). Die Baugenehmigung ist eine nur formelle Voraussetzung<br />
für die Legalität des Vorhabens, sie hat auf den materiellen Anspruch keinen Einfluss.<br />
6 Dazu Oldiges, in: Steiner (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, 7. Aufl. 2003, IV Rdnr. 140 ff.; Wahlhäuser, Die<br />
moderne städtebauliche Planung und das Planungsschadensrecht, 2002; ferner M. Deutsch, Planungsschadensrecht<br />
(§§ 39 ff. BauGB) und Eigentumsgrundrecht (Art. 14 GG), DVBl. 1995, 546 ff.<br />
96