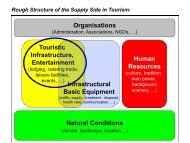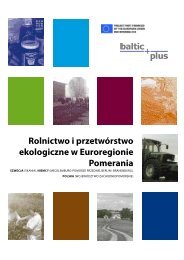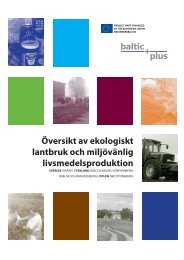umweltrechtliche Belange - Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
umweltrechtliche Belange - Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
umweltrechtliche Belange - Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Baurecht auf Zeit und Planungsschadensrecht<br />
Prinzip Anwendung: Was der Einzelne zu Eigentum bekommen hat, daran darf der Staat nicht mehr<br />
heran. Wenn man so will, wird damit dem tiefsten Wortsinn des Privateigentums Rechnung getragen<br />
– lateinisch „privare“ bedeutet berauben, und vielleicht ist der Satz „Eigentum ist Diebstahl“ (Proudhon)<br />
noch dem einen oder andern geläufig. Das BVerfG hat in der Entscheidung zur Vermögensteuer<br />
sogar gemeint, das Schäfchen-im-Trockenen-Prinzip habe Verfassungsrang, es folge aus dem Grundrecht<br />
am Eigentum, Art. 14 GG7 . Allerdings war dies kein tragender Grund der Entscheidung.<br />
a) Nach § 39 BauGB hat der Eigentümer einen Anspruch auf den Ersatz von Aufwendungen, die<br />
er im Vertrauen auf den Bestand eines rechtsverbindlichen Bebauungsplans getätigt hat. Dies betrifft<br />
etwa die Kosten für Bodenuntersuchungen, Architektenhonorare, Bau- und Finanzierungskosten.<br />
Dieser Ersatzanspruch hat letztlich nichts mit dem Eigentum zu tun, sondern mit dem allgemeinrechtsstaatlichen<br />
Vertrauensschutz8 . Gäbe es die Vorschrift nicht, müsste man dem Eigentümer den<br />
Anspruch letztlich in Analogie zu privatrechtlichen Instituten wie der culpa in contrahendo gewähren.<br />
b) Die nächsten beiden Vorschriften, §§ 40 und 41 BauGB, regeln Entschädigungsansprüche für<br />
den Fall, dass der Bebauungsplan dem Eigentümer das Grundstück gewissermaßen entzieht9 , genauer,<br />
dem Grundstück die Privatnützigkeit nimmt: Es geht um fremdnützige, heteronome Festsetzungen,<br />
z.B. um Flächen für den Gemeinbedarf, Verkehrs- und Grünflächen, Parkplätze. Die betroffenen<br />
Grundstücke kann die Gemeinde, wenn der Eigentümer sie nicht verkaufen will bzw. man sich über<br />
den Preis nicht einigt, letztlich enteignen lassen (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 BauGB). Der Eigentümer kann der<br />
Gemeinde aber auch zuvorkommen und gleichsam selbst die Enteignung beantragen. Dies ist der sog.<br />
Übernahmeanspruch, genauer: Anspruch auf Übernahme des Grundstücks gegen Entschädigung<br />
(§ 40 Abs. 2 BauGB). Die Wertung leuchtet unmittelbar ein: Der Staat nimmt dem Eigentümer endgültig<br />
etwas weg, dafür soll er bezahlen.<br />
c) Die eigentlich interessante Vorschrift ist § 42 BauGB. Sie sichert dem Eigentümer den Wert,<br />
den sein Grundstück hat, genauer: den es zum Zeitpunkt der Neuplanung dadurch hat, dass dort eine<br />
bestimmte Nutzung zulässig ist, sei es gemäß § 30 BauGB aufgrund eines bestehenden Bebauungsplans<br />
oder auch gemäß den §§ 34 und 35 BauGB. Wird diese bis dato zulässige Nutzung zum Nachteil<br />
des Eigentümers aufgehoben oder verändert10 , dann hat der Eigentümer grundsätzlich einen Anspruch<br />
auf Entschädigung für den Wertverlust. Beispiele: Die überbaubare Grundstücksfläche wird<br />
auf ein Drittel des vorher Möglichen reduziert. Oder ein Mischgebiet wird zum Gewerbegebiet umgezont,<br />
so dass ein Mietshaus an Wert verliert11 . Man spricht in diesem Fall auch von „Herabzonung“ 12 .<br />
aa) Für die Dauer von sieben Jahren besteht bei einer solchen Herabzonung gemäß § 42 Abs. 2<br />
BauGB eine absolute Wertgarantie. Das bedeutet: Auch dann, wenn der Eigentümer die Nutzungs-<br />
7 BVerfGE 93, 121. Nebenbei: Der Staat soll zudem nach dem sog. Halbteilungsgrundsatz nur das Recht haben,<br />
die Erträge aus dem Vermögen zur Hälfte zu besteuern, dem Eigentümer muss gewissermaßen auch die Hälfte<br />
der Wolle bleiben. Von diesem Halbteilungsgrundsatz hat das BVerfG allerdings soeben in einer Entscheidung<br />
zur Einkommen- und Gewerbesteuer Abstand genommen (Beschl. v. 18. 1. 2006 – 2 BvR 2194/99 –<br />
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20060118_2bvr219499.htm [21. 3. 2006]).<br />
8 M. Deutsch, DVBl. 1995, 546 (551); Wahlhäuser (Fußn. 6), S. 185.<br />
9 „Gewissermaßen“, weil nach einer der Formulierungen des BVerfG zum Begriff der Enteignung der „Entzug“<br />
und nur der Entzug des Eigentums die Enteignung kennzeichne (BVerfGE 83, 201 [211] – Vorkaufsrecht –); krit.<br />
dazu Lege, Eigentumsdogmatik und Umweltrecht, UTR 83 (2005), 7 (23).<br />
10 Dabei kommt es nicht darauf an, in welcher Weise die Aufhebung oder Änderung der Nutzung erfolgt, also<br />
etwa durch erstmaligen Bebauungsplan, Änderung eines Bebauungsplans oder Aufhebung eines Bebauungsplans.<br />
11 Nach Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 9. Aufl. 2005, § 42 Rdnr. 8.<br />
12 Vgl. z.B. BGHZ 141, 319 (327); Oldiges (Fußn. 6), Rdnr. 148; Wahlhäuser (Fußn. 6), S. 98 ff.<br />
97