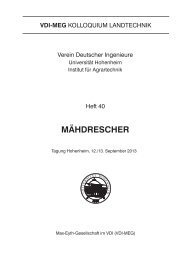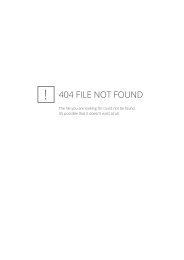Untersuchungen zur bakteriellen Erkrankung Acidovorax ...
Untersuchungen zur bakteriellen Erkrankung Acidovorax ...
Untersuchungen zur bakteriellen Erkrankung Acidovorax ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
DISKUSSION<br />
Blattgewebe als auch durch die Isolation von Bakterien aus diesen Bereichen geführt.<br />
Die Bakterienkolonien wurden anschließend im TAS-ELISA als A. valerianellae-<br />
positiv oder -negativ bestimmt. In den inokulierten Blatthälften von<br />
Feldsalatpflanzen waren lebensfähige Bakterien nach zwölf, 26 und 33 Tagen<br />
nachweisbar. Nach Isolationen aus den gegenüberliegenden nicht inokulierten<br />
Blatthälften von Feldsalat wurden ebenfalls nach zwölf und 26 Tagen lebensfähige<br />
A. valerianellae-Bakterien nachgewiesen. Das heißt, dass Bakterium hat sich in den<br />
nicht-inokulierten Blattbereich ausgebreitet.<br />
Zwölf bis 26 Tage nach der Stichinokulation waren an Pflanzenblättern der Familien<br />
Asteraceae (Lactuca sativa (L.)), Apiaceae (Petroselium crispum (Mill.) Nyman &<br />
A.W. Hill), Brassicaceae (Raphanus sativus subsp. oleiformes (L.), Raphanus<br />
sativus subsp. sativus (L.), Raphanus sativus (L.)) und Fabaceae (Phaseolus vulgaris<br />
(L.), Pisum sativum (L.)) Veränderungen sichtbar, aus denen zudem lebensfähige<br />
Bakterien isoliert wurden. Ein Nachweis lebensfähiger Bakterien war somit an allen<br />
untersuchten Pflanzen, mit Ausnahme der Pflanzen der Familie Amaranthaceae,<br />
möglich. Da sich das Bakterium bei diesen Pflanzen aber nicht in den nicht-<br />
inokulierten Blattbereich ausgebreitet hatte, wie es bei Feldsalatpflanzen der Fall<br />
war, muss davon ausgegangen werden, dass keine der untersuchten Pflanzen<br />
Wirtspflanzen von A. valerianellae waren.<br />
Bei den untersuchten Pflanzen handelte es sich sowohl um weitverbreitete Unkräuter<br />
als auch um Gemüsepflanzen. Im Pfälzer Anbaugebiet kommt es zu einer<br />
wechselnden Bewirtschaftung gleicher Flächen durch verschiedene Anbauer. Somit<br />
kann Feldsalat im Fruchtfolgewechsel eine Vor- oder Nachfrucht von Möhre-,<br />
Petersilie-, Erbse-, Zuckermais-, Eissalat-, Bataviasalat-, Radies-, Rettich- und<br />
anderen Beständen sein (persönliche Mitteilung J. Kreiselmaier, DLR Rheinpfalz).<br />
Ein Anbau von Feldsalat auf der gleichen Fläche wird von den Anbauern in der<br />
Regel in einem Abstand von zwei Jahren durchgeführt (persönliche Mitteilung<br />
J. Geil, Pfälzer Anbauer). Eine Eignung dieser Pflanzen als potentielle Wirte wäre<br />
somit theoretisch denkbar, wurde aber in diesen Versuchen nicht nachgewiesen.<br />
Als Bekämpfungsmaßnahme wären eine weite und abwechselnde Fruchtfolge zu<br />
nennen, wie sie auch MOLTMANN (1999) als Bekämpfungsmaßnahme von<br />
144