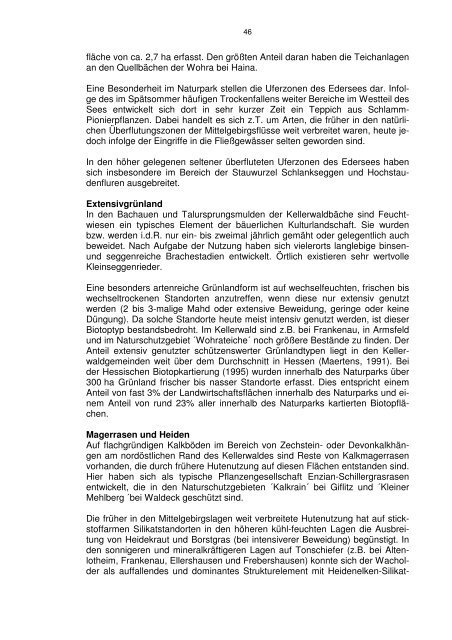naturpark kellerwald-edersee entwicklungsplanung band
naturpark kellerwald-edersee entwicklungsplanung band
naturpark kellerwald-edersee entwicklungsplanung band
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
46<br />
fläche von ca. 2,7 ha erfasst. Den größten Anteil daran haben die Teichanlagen<br />
an den Quellbächen der Wohra bei Haina.<br />
Eine Besonderheit im Naturpark stellen die Uferzonen des Edersees dar. Infolge<br />
des im Spätsommer häufigen Trockenfallens weiter Bereiche im Westteil des<br />
Sees entwickelt sich dort in sehr kurzer Zeit ein Teppich aus Schlamm-<br />
Pionierpflanzen. Dabei handelt es sich z.T. um Arten, die früher in den natürlichen<br />
Überflutungszonen der Mittelgebirgsflüsse weit verbreitet waren, heute jedoch<br />
infolge der Eingriffe in die Fließgewässer selten geworden sind.<br />
In den höher gelegenen seltener überfluteten Uferzonen des Edersees haben<br />
sich insbesondere im Bereich der Stauwurzel Schlankseggen und Hochstaudenfluren<br />
ausgebreitet.<br />
Extensivgrünland<br />
In den Bachauen und Talursprungsmulden der Kellerwaldbäche sind Feuchtwiesen<br />
ein typisches Element der bäuerlichen Kulturlandschaft. Sie wurden<br />
bzw. werden i.d.R. nur ein- bis zweimal jährlich gemäht oder gelegentlich auch<br />
beweidet. Nach Aufgabe der Nutzung haben sich vielerorts langlebige binsen-<br />
und seggenreiche Brachestadien entwickelt. Örtlich existieren sehr wertvolle<br />
Kleinseggenrieder.<br />
Eine besonders artenreiche Grünlandform ist auf wechselfeuchten, frischen bis<br />
wechseltrockenen Standorten anzutreffen, wenn diese nur extensiv genutzt<br />
werden (2 bis 3-malige Mahd oder extensive Beweidung, geringe oder keine<br />
Düngung). Da solche Standorte heute meist intensiv genutzt werden, ist dieser<br />
Biotoptyp bestandsbedroht. Im Kellerwald sind z.B. bei Frankenau, in Armsfeld<br />
und im Naturschutzgebiet ´Wohrateiche´ noch größere Bestände zu finden. Der<br />
Anteil extensiv genutzter schützenswerter Grünlandtypen liegt in den Kellerwaldgemeinden<br />
weit über dem Durchschnitt in Hessen (Maertens, 1991). Bei<br />
der Hessischen Biotopkartierung (1995) wurden innerhalb des Naturparks über<br />
300 ha Grünland frischer bis nasser Standorte erfasst. Dies entspricht einem<br />
Anteil von fast 3% der Landwirtschaftsflächen innerhalb des Naturparks und einem<br />
Anteil von rund 23% aller innerhalb des Naturparks kartierten Biotopflächen.<br />
Magerrasen und Heiden<br />
Auf flachgründigen Kalkböden im Bereich von Zechstein- oder Devonkalkhängen<br />
am nordöstlichen Rand des Kellerwaldes sind Reste von Kalkmagerrasen<br />
vorhanden, die durch frühere Hutenutzung auf diesen Flächen entstanden sind.<br />
Hier haben sich als typische Pflanzengesellschaft Enzian-Schillergrasrasen<br />
entwickelt, die in den Naturschutzgebieten ´Kalkrain´ bei Giflitz und ´Kleiner<br />
Mehlberg ´bei Waldeck geschützt sind.<br />
Die früher in den Mittelgebirgslagen weit verbreitete Hutenutzung hat auf stickstoffarmen<br />
Silikatstandorten in den höheren kühl-feuchten Lagen die Ausbreitung<br />
von Heidekraut und Borstgras (bei intensiverer Beweidung) begünstigt. In<br />
den sonnigeren und mineralkräftigeren Lagen auf Tonschiefer (z.B. bei Altenlotheim,<br />
Frankenau, Ellershausen und Frebershausen) konnte sich der Wacholder<br />
als auffallendes und dominantes Strukturelement mit Heidenelken-Silikat-