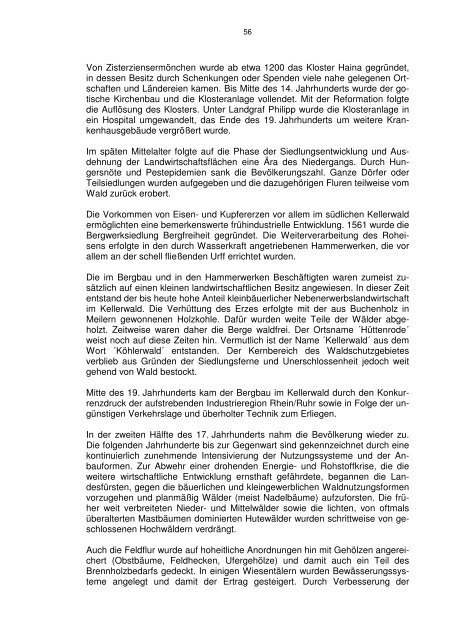naturpark kellerwald-edersee entwicklungsplanung band
naturpark kellerwald-edersee entwicklungsplanung band
naturpark kellerwald-edersee entwicklungsplanung band
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
56<br />
Von Zisterziensermönchen wurde ab etwa 1200 das Kloster Haina gegründet,<br />
in dessen Besitz durch Schenkungen oder Spenden viele nahe gelegenen Ortschaften<br />
und Ländereien kamen. Bis Mitte des 14. Jahrhunderts wurde der gotische<br />
Kirchenbau und die Klosteranlage vollendet. Mit der Reformation folgte<br />
die Auflösung des Klosters. Unter Landgraf Philipp wurde die Klosteranlage in<br />
ein Hospital umgewandelt, das Ende des 19. Jahrhunderts um weitere Krankenhausgebäude<br />
vergrößert wurde.<br />
Im späten Mittelalter folgte auf die Phase der Siedlungsentwicklung und Ausdehnung<br />
der Landwirtschaftsflächen eine Ära des Niedergangs. Durch Hungersnöte<br />
und Pestepidemien sank die Bevölkerungszahl. Ganze Dörfer oder<br />
Teilsiedlungen wurden aufgegeben und die dazugehörigen Fluren teilweise vom<br />
Wald zurück erobert.<br />
Die Vorkommen von Eisen- und Kupfererzen vor allem im südlichen Kellerwald<br />
ermöglichten eine bemerkenswerte frühindustrielle Entwicklung. 1561 wurde die<br />
Bergwerksiedlung Bergfreiheit gegründet. Die Weiterverarbeitung des Roheisens<br />
erfolgte in den durch Wasserkraft angetriebenen Hammerwerken, die vor<br />
allem an der schell fließenden Urff errichtet wurden.<br />
Die im Bergbau und in den Hammerwerken Beschäftigten waren zumeist zusätzlich<br />
auf einen kleinen landwirtschaftlichen Besitz angewiesen. In dieser Zeit<br />
entstand der bis heute hohe Anteil kleinbäuerlicher Nebenerwerbslandwirtschaft<br />
im Kellerwald. Die Verhüttung des Erzes erfolgte mit der aus Buchenholz in<br />
Meilern gewonnenen Holzkohle. Dafür wurden weite Teile der Wälder abgeholzt.<br />
Zeitweise waren daher die Berge waldfrei. Der Ortsname ´Hüttenrode´<br />
weist noch auf diese Zeiten hin. Vermutlich ist der Name ´Kellerwald´ aus dem<br />
Wort ´Köhlerwald´ entstanden. Der Kernbereich des Waldschutzgebietes<br />
verblieb aus Gründen der Siedlungsferne und Unerschlossenheit jedoch weit<br />
gehend von Wald bestockt.<br />
Mitte des 19. Jahrhunderts kam der Bergbau im Kellerwald durch den Konkurrenzdruck<br />
der aufstrebenden Industrieregion Rhein/Ruhr sowie in Folge der ungünstigen<br />
Verkehrslage und überholter Technik zum Erliegen.<br />
In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts nahm die Bevölkerung wieder zu.<br />
Die folgenden Jahrhunderte bis zur Gegenwart sind gekennzeichnet durch eine<br />
kontinuierlich zunehmende Intensivierung der Nutzungssysteme und der Anbauformen.<br />
Zur Abwehr einer drohenden Energie- und Rohstoffkrise, die die<br />
weitere wirtschaftliche Entwicklung ernsthaft gefährdete, begannen die Landesfürsten,<br />
gegen die bäuerlichen und kleingewerblichen Waldnutzungsformen<br />
vorzugehen und planmäßig Wälder (meist Nadelbäume) aufzuforsten. Die früher<br />
weit verbreiteten Nieder- und Mittelwälder sowie die lichten, von oftmals<br />
überalterten Mastbäumen dominierten Hutewälder wurden schrittweise von geschlossenen<br />
Hochwäldern verdrängt.<br />
Auch die Feldflur wurde auf hoheitliche Anordnungen hin mit Gehölzen angereichert<br />
(Obstbäume, Feldhecken, Ufergehölze) und damit auch ein Teil des<br />
Brennholzbedarfs gedeckt. In einigen Wiesentälern wurden Bewässerungssysteme<br />
angelegt und damit der Ertrag gesteigert. Durch Verbesserung der