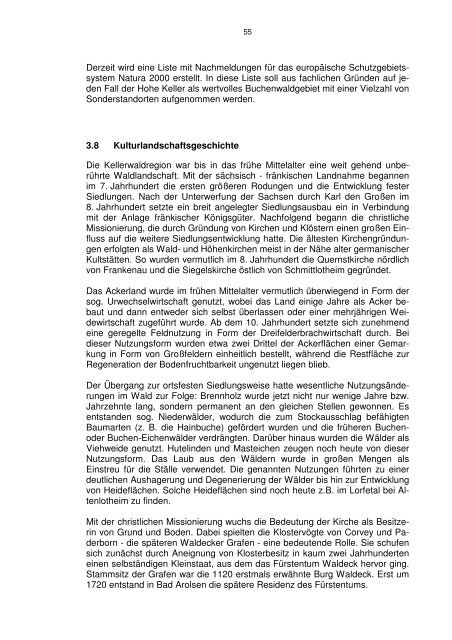naturpark kellerwald-edersee entwicklungsplanung band
naturpark kellerwald-edersee entwicklungsplanung band
naturpark kellerwald-edersee entwicklungsplanung band
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
55<br />
Derzeit wird eine Liste mit Nachmeldungen für das europäische Schutzgebietssystem<br />
Natura 2000 erstellt. In diese Liste soll aus fachlichen Gründen auf jeden<br />
Fall der Hohe Keller als wertvolles Buchenwaldgebiet mit einer Vielzahl von<br />
Sonderstandorten aufgenommen werden.<br />
3.8 Kulturlandschaftsgeschichte<br />
Die Kellerwaldregion war bis in das frühe Mittelalter eine weit gehend unberührte<br />
Waldlandschaft. Mit der sächsisch - fränkischen Landnahme begannen<br />
im 7. Jahrhundert die ersten größeren Rodungen und die Entwicklung fester<br />
Siedlungen. Nach der Unterwerfung der Sachsen durch Karl den Großen im<br />
8. Jahrhundert setzte ein breit angelegter Siedlungsausbau ein in Verbindung<br />
mit der Anlage fränkischer Königsgüter. Nachfolgend begann die christliche<br />
Missionierung, die durch Gründung von Kirchen und Klöstern einen großen Einfluss<br />
auf die weitere Siedlungsentwicklung hatte. Die ältesten Kirchengründungen<br />
erfolgten als Wald- und Höhenkirchen meist in der Nähe alter germanischer<br />
Kultstätten. So wurden vermutlich im 8. Jahrhundert die Quernstkirche nördlich<br />
von Frankenau und die Siegelskirche östlich von Schmittlotheim gegründet.<br />
Das Ackerland wurde im frühen Mittelalter vermutlich überwiegend in Form der<br />
sog. Urwechselwirtschaft genutzt, wobei das Land einige Jahre als Acker bebaut<br />
und dann entweder sich selbst überlassen oder einer mehrjährigen Weidewirtschaft<br />
zugeführt wurde. Ab dem 10. Jahrhundert setzte sich zunehmend<br />
eine geregelte Feldnutzung in Form der Dreifelderbrachwirtschaft durch. Bei<br />
dieser Nutzungsform wurden etwa zwei Drittel der Ackerflächen einer Gemarkung<br />
in Form von Großfeldern einheitlich bestellt, während die Restfläche zur<br />
Regeneration der Bodenfruchtbarkeit ungenutzt liegen blieb.<br />
Der Übergang zur ortsfesten Siedlungsweise hatte wesentliche Nutzungsänderungen<br />
im Wald zur Folge: Brennholz wurde jetzt nicht nur wenige Jahre bzw.<br />
Jahrzehnte lang, sondern permanent an den gleichen Stellen gewonnen. Es<br />
entstanden sog. Niederwälder, wodurch die zum Stockausschlag befähigten<br />
Baumarten (z. B. die Hainbuche) gefördert wurden und die früheren Buchen-<br />
oder Buchen-Eichenwälder verdrängten. Darüber hinaus wurden die Wälder als<br />
Viehweide genutzt. Hutelinden und Masteichen zeugen noch heute von dieser<br />
Nutzungsform. Das Laub aus den Wäldern wurde in großen Mengen als<br />
Einstreu für die Ställe verwendet. Die genannten Nutzungen führten zu einer<br />
deutlichen Aushagerung und Degenerierung der Wälder bis hin zur Entwicklung<br />
von Heideflächen. Solche Heideflächen sind noch heute z.B. im Lorfetal bei Altenlotheim<br />
zu finden.<br />
Mit der christlichen Missionierung wuchs die Bedeutung der Kirche als Besitzerin<br />
von Grund und Boden. Dabei spielten die Klostervögte von Corvey und Paderborn<br />
- die späteren Waldecker Grafen - eine bedeutende Rolle. Sie schufen<br />
sich zunächst durch Aneignung von Klosterbesitz in kaum zwei Jahrhunderten<br />
einen selbständigen Kleinstaat, aus dem das Fürstentum Waldeck hervor ging.<br />
Stammsitz der Grafen war die 1120 erstmals erwähnte Burg Waldeck. Erst um<br />
1720 entstand in Bad Arolsen die spätere Residenz des Fürstentums.