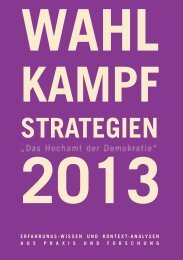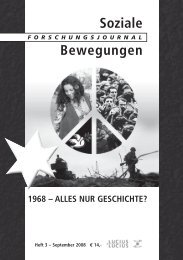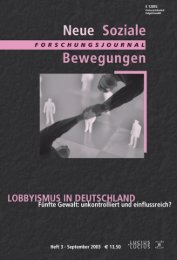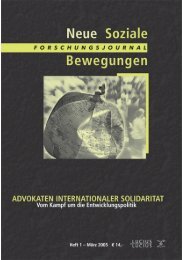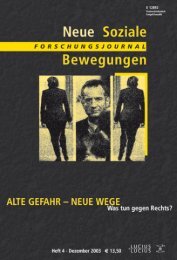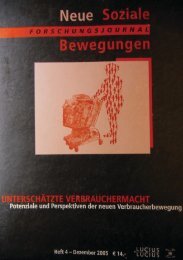Vollversion (1.57 MB) - Forschungsjournal Soziale Bewegungen
Vollversion (1.57 MB) - Forschungsjournal Soziale Bewegungen
Vollversion (1.57 MB) - Forschungsjournal Soziale Bewegungen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Literatur<br />
Neues von der Zivilgesellschaft?<br />
Jahrbücher dienen gewöhnlich zwei Aufgaben:<br />
Einerseits sind sie eine Art Rechenschaftsbericht,<br />
in dem die Tätigkeit der Institution dokumentiert<br />
ist. Andererseits können sie auch Perspektiven<br />
und geplante Programme aufzeigen.<br />
Das Jahrbuch 2003 des Wissenschaftszentrums<br />
Berlin für Sozialforschung (WZB) ist aus beiden<br />
Blickwinkeln interessant.<br />
Akzentverschiebung<br />
Mit dem Auslaufen der Abteilung Öffentlichkeit<br />
und <strong>Soziale</strong> <strong>Bewegungen</strong> 2000 und einer<br />
Herabstufung zur Arbeitsgruppe ,Politische<br />
Öffentlichkeit und Mobilisierung‘ gab es eine<br />
Akzentverschiebung am WZB, bei der die Bewegungsforschung<br />
an Stellenwert einbüßte.<br />
Ansgar Klein befürchtete damals in einer Stellungnahme<br />
im <strong>Forschungsjournal</strong> einen „Abschied<br />
auf Raten von der Bewegungsforschung“<br />
(FJ NSB 1/2001, 117-119).<br />
Nun widmet das WZB sein Jahrbuch 2003<br />
der Zivilgesellschaft, also einem Thema im weiteren<br />
Feld der Bewegungsforschung. Das Thema<br />
selbst, aber auch die Zusammenstellung des<br />
Bandes, spiegelt den Einfluss vom WZB-Präsidenten<br />
Jürgen Kocka, der das Amt Anfang 2001<br />
von dem Bewegungsforscher Friedhelm Neidhardt<br />
übernommen hatte. Kocka rief einen neuen<br />
Schwerpunkt zu ,Zivilgesellschaft, Konflikte<br />
und Demokratie‘ ins Leben, der mit zwei Abteilungen,<br />
zwei Arbeitsgruppen und einer Arbeitsstelle<br />
ähnlich wie andere Schwerpunkte<br />
ausgestattet ist. Die neu am WZB vertretene<br />
Disziplin des Historikers Kocka schlägt sich im<br />
Band nieder. So sind die Beiträge nicht nur soziologisch<br />
und politikwissenschaftlich geprägt,<br />
sondern es finden sich auch historische Artikel.<br />
Zivilgesellschaft im historischen<br />
Kontext<br />
In dem ersten der vier Abschnitte wird das Konzept<br />
der Zivilgesellschaft in einen historischen<br />
109<br />
Kontext gestellt. Dieter Gosewinkel und Dieter<br />
Rucht führen soziologische und historische Perspektiven<br />
auf Zivilgesellschaft in einem Beitrag<br />
zusammen. So wird einerseits historisch ein<br />
Blick auf Selbstdefinition und Träger von Zivilgesellschaft<br />
geworfen. Andererseits schlagen<br />
die Autoren eine systematische Konzeption von<br />
zivilgesellschaftlichem Handeln als spezifischem<br />
Modus sozialer Interaktion vor, der „nicht<br />
moralisch oder affektiv motiviert“ ist, sondern<br />
„auf der Überzeugungskraft der Vorteile kooperativen<br />
Handelns“ beruhe (S. 45f). In dieser<br />
Weise wird Zivilgesellschaft abgegrenzt von<br />
Staat, Gemeinschaften und Wirtschaft. Die Fokussierung<br />
der Zivilgesellschaft auf Solidarität<br />
lehnen die Autoren explizit ab. Damit bleibt<br />
allerdings unklar, warum sich Zivilgesellschaft<br />
von Wirtschaft unterscheidet, beruht doch auch<br />
jeder Kauf auf der wechselseitigen Einsicht in<br />
den Vorteil einer (kooperativen) Tauschhandlung.<br />
Sven Reichardt weist auf die Ambivalenzen<br />
von hoher Mobilisierung in nicht-staatlichen<br />
Vereinen hin, mit dem Verweis auf die<br />
Weimarer Republik. In dieser Zeit waren zwar<br />
viele Menschen in Vereinen aktiv, allerdings auch<br />
mit hoher Gewaltbereitschaft, was bekanntlich<br />
zur Destabilisierung des ganzen Staatswesens<br />
führte. Hier wird die Bedeutung von Zivilität<br />
für Zivilgesellschaft deutlich. Die Bedeutung<br />
von Gewalt wird auch von Ute Hasenöhrl analysiert,<br />
die sich mit zivilem Ungehorsam, also<br />
der Regelverletzung unter Gewaltverzicht, im<br />
Kontext der Anti-AKW-Bewegung beschäftigt.<br />
Zivilgesellschaftliche Organisationen<br />
Der zweite Abschnitt ,Intermediärer Bereich und<br />
Dritter Sektor‘ nimmt die zivilgesellschaftlichen<br />
Organisationen in den Blick, wobei nun Zivilgesellschaft<br />
als gesellschaftlicher Bereich und<br />
nicht als Handlungsmodus zu verstehen ist.<br />
Eckhard Priller und Annette Zimmer referieren<br />
einige interessante Ergebnisse aus dem Johns-<br />
Hopkins-Projekt mit Blick auf die ideelle Ausrichtung<br />
im Spannungsverhältnis zu wirtschaft-