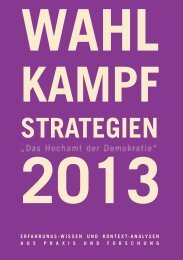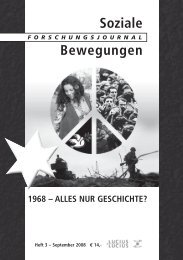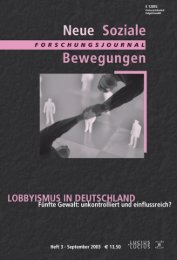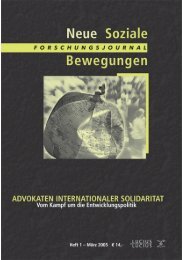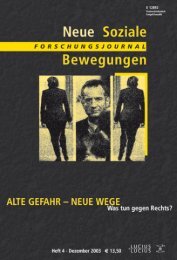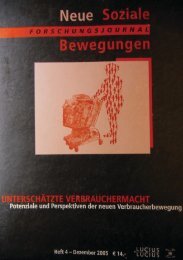Vollversion (1.57 MB) - Forschungsjournal Soziale Bewegungen
Vollversion (1.57 MB) - Forschungsjournal Soziale Bewegungen
Vollversion (1.57 MB) - Forschungsjournal Soziale Bewegungen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Literatur<br />
Umsetzung ohne Nationalstaaten. Dies wird<br />
am Beispiel des ausgesprochen erfolgreichen<br />
,Forest Stewardship Council‘ (FSC), einer<br />
globalen Zertifizierung nach ökologischen<br />
und sozialen Gesichtspunkten in der Forstwirtschaft,<br />
untersucht. Das FSC kann sich<br />
global in erstaunlichem Maße durchsetzen,<br />
weil die Zertifizierung zu einem wichtigen<br />
Argument bei politischem Konsum wird.<br />
Wolfgang van den Daele und Rainer Döbert<br />
berichten aus einem Diskursverfahren zum<br />
Zugang patentgeschützter Medikamente, an<br />
dem Pharmaunternehmen, Nicht-Regierungsorgansiationen,<br />
unabhängige Experten<br />
und Vertreter von Regulierungsinstanzen<br />
beteiligt waren. Gerade bei der Behandlung<br />
von AIDS-Patienten besteht ein tiefer Graben<br />
zwischen solidarischer Rhetorik und<br />
Zugang zu Medikamenten. Moralische Anforderungen<br />
an Unternehmen wurden in dem<br />
Diskursverfahren getestet mit dem Effekt,<br />
dass sich beide Seiten aufeinander zu bewegen<br />
müssen und Grundsätzliches anerkennen.<br />
Für Handlungen bleibt aber die Weltsolidargemeinschaft<br />
eine Vision. Dietmar Jazbinsek<br />
präsentiert und illustriert beispielhaft<br />
die These, die Zivilgesellschaft in den USA<br />
sei nicht entsprechend Putnams Behauptung<br />
in einem Niedergang begriffen, sondern entwickle<br />
sich zu einem Medienlobbyismus.<br />
Jeanette Hofmann betrachtet das Experiment<br />
der Demokratie im Netz, der Wahlen von<br />
neun Nutzervertretern in dem Gremium für<br />
einige Regulierungen im Internet (ICANN).<br />
Im Prozess dieser Wahl lässt sich beobachten,<br />
wie die Idee einer demokratischen Beteiligung<br />
von Nutzern der Internet-Community<br />
bei einer NGO an Legitimität verliert.<br />
Während Nicht-Regierungsorganisationen<br />
zunächst oftmals ein legitimatorisches Plus<br />
verbuchen können, indem sie überhaupt Partizipation<br />
gewährleisten, lässt sich an diesem<br />
Fall sehen, wie die geringe demokratische<br />
Verankerung in einer breiten Gruppe<br />
111<br />
(hier der Internetnutzer) zunehmend als Defizit<br />
angesehen wird. Zu einer skeptischen<br />
Einschätzung der Rolle von zivilgesellschaftlichen<br />
Akteuren kommt auch Helmut Weidner,<br />
der seine Überlegungen in Anlehnung<br />
an ein Diskursverfahren der Bergbau- und<br />
Metallindustrie entwickelt. Die Beteiligung<br />
von zivilgesellschaftlichen Akteuren an dem<br />
Deliberationsverfahren war, im Rahmen des<br />
möglichen, hilfreich für eine umfassende<br />
Problembetrachtung, letztlich bleiben aber<br />
die Deliberationen gegenüber starken Interessen<br />
machtlos. Dieter Rucht schließlich sortiert<br />
im letzten Beitrag des Bandes die unterschiedlichen<br />
Strömungen von Globalisierungskritikern<br />
auf ihre Ideologie und Aktionsvorstellungen<br />
hin. Dabei tut sich eine<br />
große Spannbreite unterschiedlicher Kritikausrichtungen<br />
auf und auch die Vorstellungen,<br />
wie Wandel herbeigeführt werden soll,<br />
reichen von Diskussion und Expertise bis<br />
zu Revolution der Straße. Auffällig ist<br />
allerdings die Theorieferne; ganz anders als<br />
in der Studentenbewegung der 1968er.<br />
Spannende Zusammenstellung<br />
Das Jahrbuch ist eine spannende Zusammenstellung<br />
unterschiedlicher Beiträge zum Thema<br />
Zivilgesellschaft. Dass die Autorinnen und<br />
Autoren dabei kein kohärentes gemeinsames<br />
Verständnis von Zivilgesellschaft entwickeln,<br />
kann nicht verwundern angesichts der vielen<br />
Schattierungen des Begriffs in der wissenschaftlichen<br />
Diskussion. Die einleitende Definition<br />
der Herausgeber versammelt einige<br />
Aspekte, die allerdings, insbesondere angesichts<br />
der normativen Aufladung („friedliches<br />
Handeln“, das sich „auf das allgemeine Wohl“<br />
bezieht, S. 11), in der definitorischen Zusammenstellung<br />
nicht weiterhelfen. So widersprechen<br />
praktisch alle Autoren des Bandes dieser<br />
Definition einschließlich der Autoren des<br />
ersten Beitrages, die Mitautoren der Einleitung<br />
sind. Die normative Aufladung von Zi-