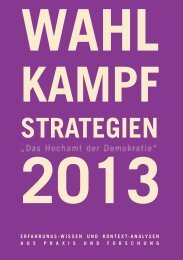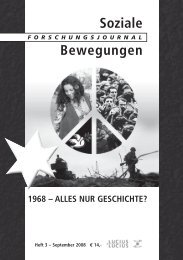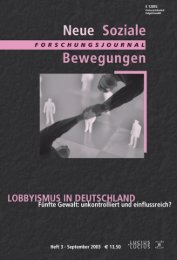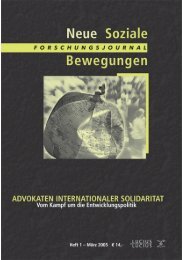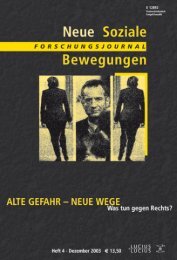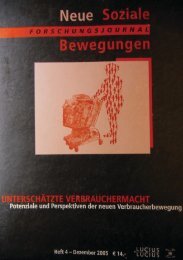Vollversion (1.57 MB) - Forschungsjournal Soziale Bewegungen
Vollversion (1.57 MB) - Forschungsjournal Soziale Bewegungen
Vollversion (1.57 MB) - Forschungsjournal Soziale Bewegungen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
86<br />
FORSCHUNGSBERICHT<br />
....................................................................................................................................<br />
Geburtshelfer oder Jungbrunnen?<br />
Das Verhältnis von Religion und sozialer<br />
Bewegung am Beispiel der DDR-<br />
Friedensbewegung<br />
„Eigentlich kannst du, wenn du Friedensarbeit<br />
machst, kannst du eigentlich, wenn du kritisch<br />
hinguckst nur den Strick nehmen (hm) weil’s<br />
eigentlich ziemlich sinnlos ist – kurzfristig gesehen.“<br />
(Frau D: 727ff) 1 Man muss nicht gleich<br />
des Lebens müde werden ob der, auf den ersten<br />
Blick, Vergeblichkeit des Engagements. Den<br />
Strick zu nehmen kann ja metaphorisch auch<br />
bedeuten, den Vorhang der politischen Bühne<br />
zu schließen, abzutreten und sich fortan dem<br />
privaten Glück zu widmen. Das Zitat aus einem<br />
der biographischen Interviews führt aber<br />
unversehens zu Albert Camus. Der Selbstmord<br />
sei eine Grundfrage der Philosophie, so heißt<br />
es bei ihm, geht es doch darum, ob sich das<br />
Leben lohne (Camus 1997: 10ff) oder eben der<br />
Kampf gegen das Elend der Welt. Seine Antwort<br />
ist die Mythenfigur des Sisyphos, der verdammt<br />
wurde zum aussichtlosen Kampf gegen<br />
den Gipfel des Berges. Aussichtslos, da der<br />
mühsam hinaufgewuchtete Stein unablässig<br />
wieder herunterrollt. Und doch sei Sisyphos in<br />
diesem vergeblichen Tun eigentümlich glücklich.<br />
In meiner Magisterarbeit, mit dem Titel<br />
„Engagement trotz Enttäuschung. Eine biographieanalytische<br />
Untersuchung von Triebkräften<br />
gesellschaftlicher Veränderung“ habe ich<br />
mich der Beantwortung dieser Frage explorativ<br />
genähert: Was veranlasst Menschen, allen Enttäuschungen<br />
und Rückschlägen zum Trotz, in<br />
einem bestimmten Segment sozialer <strong>Bewegungen</strong><br />
über Jahrzehnte hinweg aktiv zu bleiben?<br />
In narrativ-biographischen Interviews wurden<br />
8 Oppositionelle aus der unabhängigen kirchlichen<br />
DDR-Friedensbewegung befragt 2 , die heute<br />
noch aktiv sind, über den 1989er Zeitenbruch<br />
hinaus. Die Ärztin, der Pfarrer, der Kraftfahrer<br />
<strong>Forschungsjournal</strong> NSB, Jg. 17, 4/2004<br />
uvm. sie alle haben zu DDR-Zeiten, durchaus<br />
in verschiedene Richtungen, an jenem Stein geschoben,<br />
der Ende der 1980er ins Rollen kam<br />
und 1989 ihnen völlig den Händen entglitt. 3 An<br />
unterschiedlicher Stelle haben Sie das Steinwälzen<br />
fortgesetzt, in der Arbeit mit Langzeitarbeitslosen,<br />
dem Einsatz für Frieden auf dem<br />
Balkan oder in der Fortführung des ältesten noch<br />
aktiven Friedensseminars der DDR.<br />
Fokussiert auf das Thema des Heftes, werde<br />
ich im folgenden speziell die Funktion der<br />
christlichen Religion für den Beginn und vor<br />
allem für die Langlebigkeit dieses Engagements<br />
in aller Kürze darzustellen versuchen.<br />
Initiativimpulse<br />
Christian Smith zufolge ist die Religion die<br />
„midwife“, die Hebamme sozialer <strong>Bewegungen</strong><br />
(Smith 1996: 16). Diese einfühlsame Zuschreibung<br />
wird Sie sich aber in meinem Fall<br />
mit dem SED-Staat teilen müssen. Inmitten der<br />
„Integrierten Generation“ (Lindner 2003: 35ff)<br />
der um 1945 bis 1960 Geborenen, die besonders<br />
fest und nachhaltig in der DDR verwurzelt war,<br />
schuf die DDR mit ihrer zunächst ausgrenzenden<br />
Kirchenpolitik ein distanziertes christliches<br />
Protestmilieu. Als Beispiel sei Herr A. zitiert:<br />
„Also den Zehnjahresabschluss zu machen, das<br />
war nicht möglich weil ich konfirmiert worden<br />
bin.“ (Herr A: 18f) Diese Benachteiligungserfahrungen<br />
sind allen Interviewten gemeinsam.<br />
Am Beginn des Engagements steht also ein<br />
staatlich provozierter „Abstoßungseffekt“<br />
(Hirschman 1988: 88). Diese Distanz wiederum<br />
wird in den meisten biographischen Texten verstärkt<br />
durch das DDR-kritische kirchliche Umfeld.<br />
Wo wird aber der Beginn des Engagements<br />
verortet? Hier lassen sich zwei idealtypische<br />
Initiativimpulse unterscheiden und geschlechtspezifisch<br />
zuordnen.<br />
Die Männer werden in ihrer Rolle als Staatsbürger<br />
konfrontiert mit der Entscheidung sich<br />
zur NVA anwerben zu lassen oder aber mit der<br />
Einführung der Wehrpflicht 1961 den Wehr-