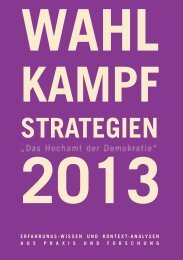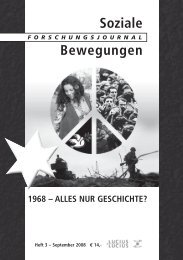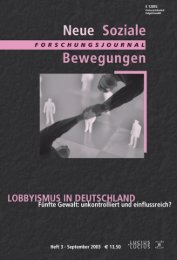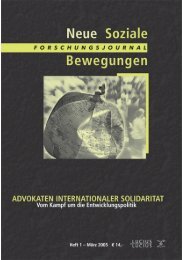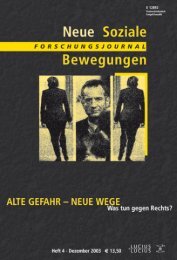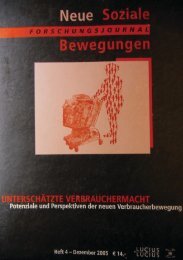Vollversion (1.57 MB) - Forschungsjournal Soziale Bewegungen
Vollversion (1.57 MB) - Forschungsjournal Soziale Bewegungen
Vollversion (1.57 MB) - Forschungsjournal Soziale Bewegungen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
30<br />
und religiösen <strong>Bewegungen</strong> stehen konzeptionelle<br />
Vorentscheidungen, die spezifische Selektivitäten<br />
bei der Gegenstandsbestimmung zur<br />
Folge hatten.<br />
So hat sich vor allem die amerikanische Bewegungsforschung<br />
überwiegend auf solche<br />
sozialen <strong>Bewegungen</strong> konzentriert, die wirtschaftlichen<br />
oder politischen Wandel mit politischen<br />
Mitteln zu erreichen suchten (Williams<br />
2000: 2), d.h. auf den Typus der machtorientierten<br />
Bewegung (Raschke 1988: 110-112). Die<br />
europäische Forschung zu den sogenannten<br />
neuen sozialen <strong>Bewegungen</strong> hat zwar neben dem<br />
machtorientierten auch den Typus der kulturorientierten<br />
Bewegung in den Blick genommen.<br />
Aber auch in der europäischen Bewegungsforschung<br />
haben letztlich Analysen machtorientierter<br />
<strong>Bewegungen</strong> dominiert.<br />
Demgegenüber wurden und werden religiöse<br />
<strong>Bewegungen</strong> in der Regel als wertorientierte<br />
<strong>Bewegungen</strong> im Sinne Smelsers betrachtet, die<br />
Personen, nicht aber Strukturen oder soziale<br />
Verhältnisse zu verändern trachten (Hannigan<br />
1991: 319), bzw. als kulturorientierte <strong>Bewegungen</strong>,<br />
die nicht daran interessiert sind, ihre Wertorientierungen<br />
im politischen Prozess verbindlich<br />
zu machen, sondern sich in den Bereich des<br />
Privaten zurückziehen, um dort ihre Lebensweise<br />
praktizieren zu können (Offe 1985: 827).<br />
Als wert- oder kulturorientiert klassifiziert,<br />
konnten religiöse <strong>Bewegungen</strong> aber nicht mehr<br />
in den Fokus einer überwiegend auf die Analyse<br />
machtorientierter <strong>Bewegungen</strong> ausgerichteten<br />
Bewegungsforschung geraten.<br />
Umgekehrt hat auch die Religionssoziologie<br />
ihrerseits zur Separierung der Forschung<br />
von sozialen und religiösen <strong>Bewegungen</strong> und<br />
letztlich auch zu ihrer Selbstisolierung im Feld<br />
der Sozialwissenschaften beigetragen. Sie konzipierte<br />
Religion als einen eigenen Bereich des<br />
<strong>Soziale</strong>n, dessen empirisches Korrelat klar identifizierbare<br />
organisatorische Formen wie Kirchen,<br />
Sekten und religiöse <strong>Bewegungen</strong> sowie<br />
deren Lehren und Praktiken sind. Eine solche<br />
Ulrich Willems<br />
Perspektive richtet den Blick eher auf die spezifischen<br />
Charakteristika des Religiösen und stärker<br />
auf die Unterschiede als auf die Gemeinsamkeiten<br />
zwischen religiösen und anderen sozialen<br />
Organisationsformen und sozialen Praktiken.<br />
Zudem wurde damit schon auf konzeptioneller<br />
Ebene die Möglichkeit der Frage danach<br />
ausgeschlossen, ob und in welchem Ausmaß<br />
Religion eine Dimension sozialen Handelns<br />
auch jenseits der Kirchenmauern bildet (Demerath<br />
III/Schmitt 1998: 381).<br />
Diese durch theoretische und analytische<br />
Zugänge beförderten Tendenzen zur Ausblendung<br />
der Religion bei der Analyse sozialer <strong>Bewegungen</strong><br />
wurden von der Gegenstandsseite<br />
her zusätzlich dadurch verstärkt, dass der ‚religiöse<br />
Faktor’ in den lange Zeit im Zentrum der<br />
Aufmerksamkeit der Bewegungsforschung stehenden<br />
Studenten-, Frauen und Umweltbewegungen<br />
eine vergleichsweise geringere, wenn<br />
auch sicherlich unterschätzte Rolle spielte (Smith<br />
1996a: 3-4).<br />
3 Exkurs: Religion in der Moderne<br />
Wenn diese Rekonstruktion der säkularisierungstheoretischen<br />
Hintergrundüberzeugungen<br />
und der konzeptionellen gegenstandsbezogenen<br />
Vorentscheidungen zutreffend ist, dann wird der<br />
Verweis auf die eingangs angedeuteten empirischen<br />
Befunde einer Renaissance der Religion<br />
allein nicht ausreichen, die Bewegungsforschung<br />
(wie auch die Sozialwissenschaften<br />
insgesamt) zu einer angemesseneren Berücksichtigung<br />
der Religion sowie religiöser Organisationen,<br />
<strong>Bewegungen</strong> und Traditionen bei<br />
der Erforschung sozialer <strong>Bewegungen</strong> zu veranlassen.<br />
Daher sollen im Folgenden das Säkularisierungstheorem<br />
und die These vom traditionalistischen<br />
oder gegenmodernen Charakter<br />
des Religiösen in der Moderne noch einmal genauer<br />
betrachtet werden.<br />
Das Säkularisierungstheorem ist von zwei<br />
Seiten unter Druck geraten. Theoretisch sieht