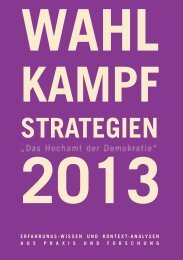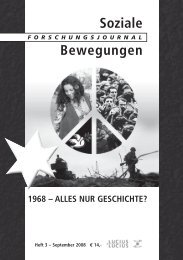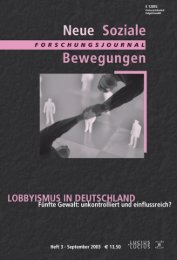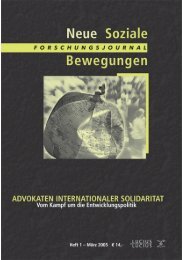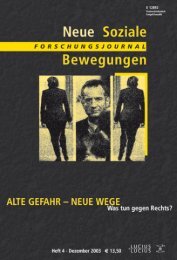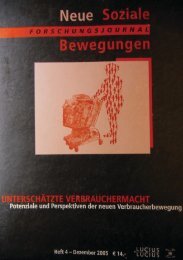Vollversion (1.57 MB) - Forschungsjournal Soziale Bewegungen
Vollversion (1.57 MB) - Forschungsjournal Soziale Bewegungen
Vollversion (1.57 MB) - Forschungsjournal Soziale Bewegungen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
6<br />
mus unberücksichtigt lassen. Reetz plädiert<br />
dafür, islamistische <strong>Bewegungen</strong> stärker anhand<br />
ihrer sozialen Aktivitäten wie auch religiösen<br />
Motive zu differenzieren. So sieht er unterschiedliche<br />
Grundtypen: Gruppen, die religiös<br />
argumentieren, um sich am politischen System<br />
zu beteiligen, militante Gruppen, die zur Durchsetzung<br />
ihrer Ziele theologische Begründungen<br />
einsetzen, islamistische Sozialverbände, die wie<br />
NGOs arbeiten und eine islamische Zivilgesellschaft<br />
prägen, sowie eher missionarische Gruppierungen<br />
ohne direkte politische Ansprüche.<br />
Anhand Japans zeigt Iris Wieczorek die Rolle<br />
und politische Einflussnahme von neuen religiösen<br />
<strong>Bewegungen</strong> auf. Das Land eignet sich<br />
dafür insbesondere, da das Phänomen der neuen<br />
religiösen <strong>Bewegungen</strong> im Vergleich zu den<br />
USA und Europa dort stärker ausgeprägt ist. Es<br />
existieren über 600 religiöse Gruppen, an denen<br />
sich bis zu 20% der japanischen Bevölkerung<br />
beteiligen. Diese neuen religiösen <strong>Bewegungen</strong><br />
sind Indikatoren und Träger von sozialem<br />
Wandel und haben Nischen alternativer Lebensstile<br />
geschaffen. Wieczorek untersucht, wie<br />
sich Aspekte des Wertewandels und der politischen<br />
Gelegenheitsstrukturen auf Mobilisierungsaktivitäten<br />
religiöser <strong>Bewegungen</strong> in Japan<br />
auswirken.<br />
Joachim Süss wendet sich den Konflikten<br />
um die neuen religiösen <strong>Bewegungen</strong> in der<br />
Bundesrepublik zu. Er kritisiert, dass Staat und<br />
Kirchen auf die Pluralisierung der religiösen<br />
Angebote mit einem delegitimierenden Diskurs<br />
reagiert haben, der diese <strong>Bewegungen</strong> als ‚Sekten‘<br />
diskreditiert und als Gefahr für die Gesellschaft<br />
bezeichnet. Trotz ihrer Feststellung, von<br />
den Sekten gehe keine ‚ernsthafte Bedrohung‘<br />
aus, hat die eigens eingesetzte Enquete-Kommission<br />
des Deutschen Bundestags rechtliche<br />
und soziale Reglementierungen empfohlen.<br />
Süss behandelt beispielhaft den Umgang mit<br />
der Scientology Kirche. Der Konflikt um den<br />
Umgang mit den sogenannten neuen religiösen<br />
<strong>Bewegungen</strong> dreht sich jedoch nicht nur um die<br />
Editorial<br />
empirische Frage, ob oder inwieweit von diesen<br />
<strong>Bewegungen</strong> Gefahren für die Mitglieder<br />
oder die Gesellschaft ausgehen. Im Hintergrund<br />
steht, wie David Bromley zuletzt deutlich gemacht<br />
hat, eine normative und politische Auseinandersetzung,<br />
die sich um das Prinzip der Autonomie<br />
dreht: Während die einen die Autonomie<br />
der Mitglieder vor ihrer vermeintlichen Gefährdung<br />
durch die neuen religiösen <strong>Bewegungen</strong><br />
schützen wollen und dementsprechend für<br />
staatliche Schutzmaßnahmen plädieren, suchen<br />
die anderen die Autonomie der Mitglieder neuer<br />
religiöser <strong>Bewegungen</strong> in Form individueller und<br />
kollektiver Religionsfreiheit zu verteidigen.<br />
Alexander Leistner erörtert in seinem Beitrag<br />
in der Rubrik Pulsschlag das Verhältnis<br />
von Religion und sozialer Bewegung am Beispiel<br />
der Friedensbewegung. Hingewiesen sei<br />
mit Blick auf den Themenschwerpunkt auch<br />
noch auf zwei Rezensionen zum Thema Religion<br />
und Bewegung in diesem Heft: ‚Die christliche<br />
Rechte in den USA’ und ‚Jesus Freaks –<br />
ganz normale Gläubige?’<br />
Nele Boehme, Berlin/Ansgar Klein, Berlin/Anja<br />
Löwe, Berlin/ Ulrich Willems, Darmstadt<br />
Erratum zu Heft 3/2005<br />
Im Beitrag von Niederhafner/Speth ‚Die<br />
Ministerialbürokratie in Deutschland – Vom<br />
Kellner zum Koch‘ des vergangenen Heftes des<br />
<strong>Forschungsjournal</strong>s (Heft 3/2005) ist ein Zitat<br />
nicht als solches ausgewiesen worden. Auf Seite<br />
26 wird der Begriff ‚administrative Gesetzgebung’<br />
verwendet, ohne auf den Urheber und<br />
Ort des Begriffs zu verweisen: Ralf Tils, ‚Politische<br />
vs. administrative Gesetzgebung. Über<br />
die Bedeutung der Ministerialverwaltung im<br />
Gesetzgebungsverfahren‘, in: Recht und Politik,<br />
Jg. 38, H. 1, 13-22. Die Autoren bedauern<br />
diese versehentliche Unterlassung, zumal die<br />
nachfolgenden Erläuterungen eine Paraphrase<br />
des Artikels sind.<br />
Die Redaktion