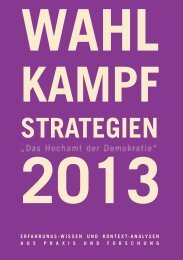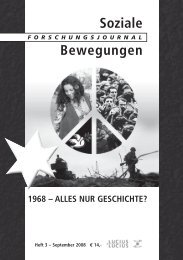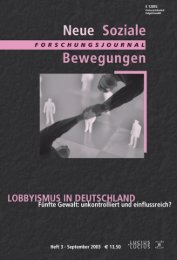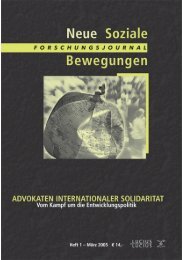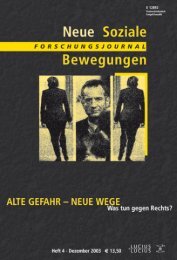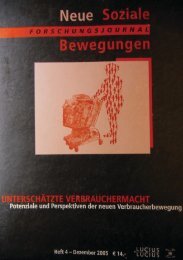Vollversion (1.57 MB) - Forschungsjournal Soziale Bewegungen
Vollversion (1.57 MB) - Forschungsjournal Soziale Bewegungen
Vollversion (1.57 MB) - Forschungsjournal Soziale Bewegungen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Der Sektenkomplex<br />
befürchten, auch mit ihren Angeboten unter die<br />
Neuregelungen zu fallen.<br />
Bemerkenswert auch dies: Als der Deutsche<br />
Bundestag in der letzten Legislaturperiode ein<br />
Antidiskriminierungsgesetz beriet, war die Evangelische<br />
Kirche mit dem geplanten Verbot religiöser<br />
Diskriminierung nicht einverstanden und<br />
beharrte auf einem Sonderstatus (Neues<br />
Deutschland vom 29.05.2002). Anscheinend<br />
fürchtete man, dass ein solches Gesetz die Arbeit<br />
kirchlicher Sektenbeauftragter erschweren<br />
würde.<br />
In einer global offenen Gesellschaft gelingt<br />
es religiösen Gemeinschaften heute nicht mehr,<br />
selbstevidente Wahrheiten in abgeschotteten<br />
kulturellen Kontexten zu vertreten. Vielmehr stehen<br />
ihre jeweiligen Wahrheitsansprüche mit denen<br />
anderer Glaubensgemeinschaften im Wettbewerb<br />
(Leggewie 2001: 21f). Dies betrifft in<br />
besonderem Maße die christlichen Kirchen, die<br />
innerhalb einer pluralisierten Religionslandschaft<br />
nur noch als primi inter pares herausragen<br />
(Leggewie 2001: 24).<br />
Die Intention des pluralisierungskritischen<br />
Diskurses, durch eine öffentliche Pathologisierung<br />
die Mitgliedschaft in einer neureligiösen<br />
Bewegung als zerstörerischen Irrweg hinzustellen,<br />
zielt in letzter Konsequenz darauf<br />
ab, die Option der freien Wahl zwischen religiösen<br />
Alternativen zu delegitimieren (Seiwert<br />
2004: 88). Es sind deshalb auch nicht die einzelnen<br />
‚Sekten’ an sich, die die kirchliche Dominanz<br />
bedrohen, sondern es ist die Vorstellung,<br />
dass alle Religionen prinzipiell gleichwertig<br />
sind und allen Menschen als Optionen<br />
offen stehen (Seiwert 2004: 87). Erst die Wahlmöglichkeit<br />
zwischen einer Vielzahl von Sinnangeboten<br />
nämlich bedroht den Status Quo der<br />
althergebrachten religiösen Ordnung und sie<br />
irritiert, so darf hinzugefügt werden, zugleich<br />
jene gesellschaftlichen Gruppen, die auf die<br />
eine oder andere Art auf diese Ordnung bezogen<br />
sind. Deshalb muss der Bevölkerung die<br />
Urteilskraft abgesprochen werden, in Sachen<br />
83<br />
Religion für sich selber sorgen zu können, wie<br />
der Religionssoziologe Hubert Seiwert bemerkt<br />
(Seiwert 2004: 90f).<br />
Der pluralisierungskritische Diskurs<br />
schweißt Interessengruppen zusammen, die<br />
sonst eher entgegengesetzten Lagern angehören,<br />
darunter linke Medienvertreter, Sozialdemokraten<br />
und die Verfechter eines aufgeklärten<br />
Säkularismus, die sich zwar notgedrungen mit<br />
dem Vorhandensein gezähmter Volkskirchen arrangiert<br />
haben, denen sonst aber alles Religiöse<br />
ein Gräuel ist. Sie agieren im Verein mit Konservativen,<br />
Theologen und den Sachwaltern des<br />
staats-kirchlichen Status Quo, die dafür kämpfen,<br />
dass die noch vorhandenen Reste des volkskirchlichen<br />
Einflusses nicht noch weiter erodieren<br />
und die Gesellschaft in einen aus ihrer<br />
Sicht undifferenzierten Laizismus abgleitet.<br />
Die Delegitimierung der freien Entscheidungswahl<br />
des Individuums kann vielleicht noch<br />
eine Zeit lang die Fiktion aufrecht erhalten, dass<br />
es auf dem Gebiet des Religiösen nur Kirchenmitgliedschaft,<br />
vielleicht gerade noch die Partizipation<br />
an einer der anderen sog. Weltreligionen,<br />
schließlich noch Religionslosigkeit, sonst<br />
aber weiter nichts geben kann. Das Rad der<br />
Religionsgeschichte lässt sich jedoch nicht mehr<br />
zurückdrehen. Deshalb gilt für den Prozess der<br />
religiös-weltanschaulichen Pluralisierung insgesamt,<br />
was Claus Leggewie mit Blick auf die<br />
Präsenz des Islam in Deutschland so formuliert:<br />
„Die religiös-politische Achse dreht sich<br />
... weg von der fiskalischen, sozial- und bildungspolitischen<br />
Bevorzugung der christlichen<br />
Konfessionen hin zur marktförmigen Koexistenz<br />
aller möglichen Bekenntnisse“ (Leggewie<br />
2001: 26).<br />
Es genügt aber nicht, das Faktum der religiösen<br />
Pluralität lediglich zu benennen. Vielmehr<br />
ist ein gesellschaftlicher Lernprozess erforderlich,<br />
der einen angemessenen Umgang mit diesem<br />
Faktum einübt. Auch von den minoritären<br />
Religionsgemeinschaften darf dabei erwartet<br />
werden, dass sie sich an diesem Lernprozess