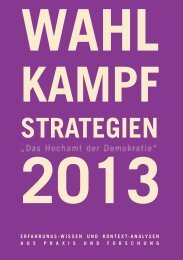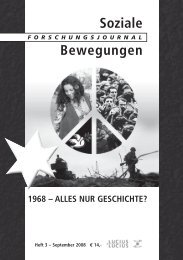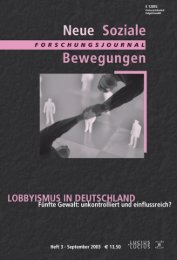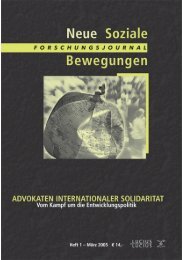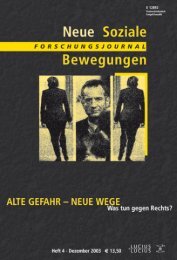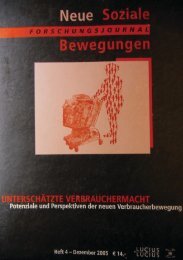Vollversion (1.57 MB) - Forschungsjournal Soziale Bewegungen
Vollversion (1.57 MB) - Forschungsjournal Soziale Bewegungen
Vollversion (1.57 MB) - Forschungsjournal Soziale Bewegungen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
32<br />
spiele für die ‚Renaissance‘ des Religiösen zeigen<br />
– keineswegs mit der Erosion von Religiosität<br />
insgesamt verwechselt werden darf). Denn<br />
diese Erosion organisierter Religiosität in Form<br />
etwa des Mitgliederverlustes der verfassten Kirchen<br />
befördert die Nutzung von Religion als<br />
kultureller Ressource, weil der Bedeutungsverlust<br />
und die Schwächung religiöser Organisationen<br />
auch ihr Interpretationsmonopol erodiert.<br />
Religiöse Symbole, Bedeutungen und Werte<br />
werden dadurch gleichsam dereguliert und ausbeutbarer<br />
(Beckford 2001: 232).<br />
Aber auch die Charakterisierung von Religion<br />
und religiösen <strong>Bewegungen</strong> als traditionalistisch<br />
und/oder gegenmodern erweist sich als<br />
nicht haltbar. Empirisch lässt sich zunächst darauf<br />
verweisen, dass religiöse Akteure und Organisationen<br />
eine wichtige Rolle in ‚fortschrittlichen‘<br />
– also Werten wie Freiheit, Gleichheit<br />
oder Gerechtigkeit verpflichteten – <strong>Bewegungen</strong><br />
wie den Bürgerrechts- und Bürgerbewegungen<br />
und der Solidaritätsbewegung gespielt<br />
haben.<br />
Als nicht stichhaltig erweisen sich auch die<br />
beiden Theoreme, die zu einem großen Teil für<br />
diese pejorative Etikettierung der Religion als<br />
traditionalistisch verantwortlich sind. Das gilt<br />
zunächst für die These des politiktheoretischen<br />
Liberalismus vom besonderen epistemischen<br />
Charakter religiöser Gründe, der sie angeblich<br />
untauglich macht, als alleinige Basis der Legitimation<br />
politischer Entscheidungen und damit<br />
der Anwendung von Zwang zu dienen (vgl. Audi<br />
2000). Denn weder sind religiöse Argumente in<br />
besonderer oder gar durchgängiger Weise für<br />
nichtreligiöse Bürgerinnen und Bürger unzugänglich<br />
oder unverständlich – sind sie doch<br />
Ergebnis einer diskursiven Prüfung und Reflexion<br />
durch Laien und theologische Experten,<br />
was sie in aller Regel zumindest nachvollziehbar<br />
macht –, noch lässt sich ein besonderer und<br />
durchgängiger Vorzug der Kategorie der säkularen<br />
Gründe mit Blick auf ihre Zugänglichkeit<br />
oder Zustimmungsfähigkeit erkennen: Argu-<br />
Ulrich Willems<br />
mente auf der Basis des Utilitarimus etwa lassen<br />
sich zwar verstehen, allgemein zustimmungsfähig<br />
sind sie aufgrund ihrer sehr spezifischen<br />
Voraussetzungen und Annahmen deshalb<br />
noch lange nicht (Willems 2003: 93-98). 1<br />
Als problematisch erweist sich auch das<br />
Werturteil, die in moralischen Konflikten oder<br />
Wertkonflikten von religiösen <strong>Bewegungen</strong> vertretenen<br />
Positionen seien nicht nur traditionell<br />
in dem Sinne, dass sie einer ‚alten‘ moralischen<br />
Tradition entstammten, sondern auch traditionalistisch<br />
oder gar fundamentalistisch in dem<br />
Sinne, dass sie mit dem moralischen Programm<br />
der Moderne mit seinem Fokus auf Schadensvermeidung<br />
bzw. auf die Sicherung individueller<br />
Autonomie konfligierten. Um es an der für<br />
moderne Wertkonflikte prototypischen Frage der<br />
Regelung des Schwangerschaftsabbruches zu<br />
verdeutlichen: Weder ist das (übrigens nicht nur<br />
von religiösen Gruppen) postulierte Lebensrecht<br />
des Fötus mit dem moralischen Programm der<br />
Moderne unvereinbar oder ‚unvernünftig‘ – die<br />
Verfechter eines Lebensrechts des Fötus vertreten<br />
schlichtweg nur eine andere religiöse bzw.<br />
weltanschauliche Auffassung in der (natur-)wissenschaftlich<br />
nicht entscheidbaren Frage des<br />
Beginns des Lebens als die Kritiker eines solchen<br />
Lebensrechtes – noch sind andere Lösungen<br />
des Wertkonfliktes zwischen dem postulierten<br />
Lebensrecht des Fötus und dem Selbstbestimmungsrecht<br />
von Frauen als die klassische<br />
liberale Privatisierung unvereinbar mit diesem<br />
Programm. Die Wertpositionen religiöser<br />
<strong>Bewegungen</strong> operieren auf der gleichen Augenhöhe<br />
wie ihre säkularen Konkurrenten. Sie bilden<br />
eine Stimme unter anderen. Als fundamentalistisch<br />
wären eher solche Positionen zu bezeichnen,<br />
die das Faktum der Pluralität nicht<br />
zur Kenntnis nähmen und dementsprechend die<br />
Suche nach Lösungen nicht für notwendig erachteten,<br />
die für alle Beteiligten akzeptabel wären<br />
– und solche Positionen wiederum werden<br />
keineswegs nur von religiösen Organisationen<br />
vertreten.