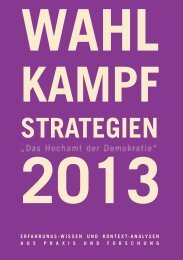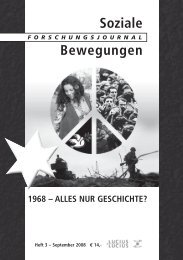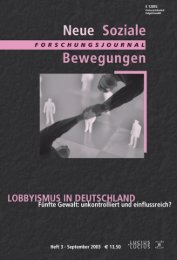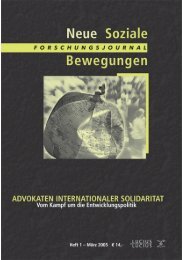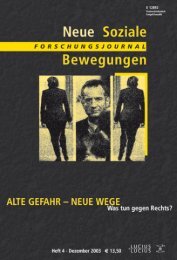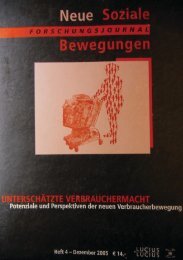Vollversion (1.57 MB) - Forschungsjournal Soziale Bewegungen
Vollversion (1.57 MB) - Forschungsjournal Soziale Bewegungen
Vollversion (1.57 MB) - Forschungsjournal Soziale Bewegungen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Der Sektenkomplex<br />
Diskurs um die neuen religiösen <strong>Bewegungen</strong> 2 ,<br />
die in der Öffentlichkeit meist mit Begriffen wie<br />
‚destruktive Kulte‘, ‚Sekten‘, ‚Psychosekten‘<br />
etc. etikettiert und pauschal zu einer Gefahr für<br />
den Einzelnen und die Gesellschaft stilisiert<br />
werden. 3 Demgegenüber kam ein akademischer<br />
Diskurs anders als in Großbritannien und den<br />
USA hierzulande nur ansatzweise zustande (vgl.<br />
Süss 2002). Und die Anhänger dieser neuen<br />
Richtungen kommen innerhalb dieses Diskurses<br />
bestenfalls als Opfer raffgieriger Gurus und<br />
gefährlicher Psychopraktiken vor.<br />
Die Debatte, in der immerhin so weitreichende<br />
Forderungen wie Verbote von Gruppierungen<br />
und damit die Beschränkung des Verfassungsrechts<br />
auf Religionsfreiheit artikuliert<br />
werden, findet weitgehend ohne Rückgriff auf<br />
wissenschaftlich gesicherte, empirische Daten<br />
statt. 4 Auch für das Bild der neuen Religiosität,<br />
das von Politikern, kirchlichen Weltanschauungsbeauftragten<br />
und Medienvertretern gezeichnet<br />
wird, gilt, was die Sozialwissenschaftlerin<br />
Birgit Rommelspacher für den gesellschaftlichen<br />
Umgang mit Fremdem insgesamt konstatiert,<br />
dass nämlich die Gewissheit des Fremdbildes<br />
in einem eigenartigen Kontrast zur Unbekanntheit<br />
des Fremden stehe (vgl. Rommelspacher<br />
2002: 10). Ohne ausreichende empirische<br />
Fundierung seitens der Wissenschaft aber<br />
bleibt es bestimmten Interessengruppen überlassen,<br />
ihr Verständnis von nichtkonventioneller<br />
Religiosität gesellschaftlich durchzusetzen<br />
(vgl. Rommelspacher 2002: 12).<br />
Noch in den 1950er und 1960er Jahren beschäftigte<br />
sich lediglich eine kleine Schar evangelischer<br />
Theologen in der Evangelischen Zentralstelle<br />
für Weltanschauungsfragen (EZW) mit<br />
jenen Grüppchen von ‚Sehern, Grüblern, Enthusiasten‘<br />
(Hutten 1982), die sich an den Rändern<br />
der Volkskirche gebildet hatten. Mit dem<br />
Einsetzen der Anti-Sekten-Kampagne in den<br />
1970er Jahren nahm die Zahl jener professionell<br />
agierenden Pluralisierungsgegner deutlich<br />
zu, die die religionsgeschichtlichen Veränderun-<br />
79<br />
gen vor allem als Bedrohung wahrnahmen<br />
(Usarski 1988: 159ff). Immer mehr Pfarrer, Privatpersonen<br />
und Journalisten spezialisierten sich<br />
als sog. ‚Sektenexperten‘. Heute sind in der<br />
Bundesrepublik Deutschland etwa 60 kirchliche<br />
Weltanschauungsbeauftragte im Bereich der<br />
EKD und der römisch-katholischen Kirche tätig<br />
(vgl. Besier/Scheuch 1999: 11f).<br />
Hinzu kommen weitere Beauftragte der Länder,<br />
ein eigenes Referat im Bundesfamilienministerium<br />
und eine entsprechende Stelle im Bundesverwaltungsamt<br />
(vgl. Besier/Scheuch 1999:<br />
11f). Diese sind im Bund-Länder-Gesprächskreis<br />
‚Sogenannte Sekten und Psychogruppen‘<br />
und in einer Interministeriellen Arbeitsgruppe<br />
‚Scientology‘ miteinander vernetzt. Weitere Arbeitsebenen<br />
wurden in den Ländern zwischen<br />
einzelnen Ressorts etabliert.<br />
Daneben existieren ca. 20 größere sog.<br />
Selbsthilfegruppen wie ‚SINUS‘ in Frankfurt,<br />
die ‚Aktion für geistige und psychische Freiheit‘<br />
(AGPF) in Bonn und das ‚Sekten-Info‘ in Essen,<br />
die mit öffentlichen Geldern bezuschusst<br />
werden (vgl. Besier/Scheuch 1999: 17f). Weiterhin<br />
arbeiten zahlreiche private bzw. halb private<br />
Gruppen auf regionaler und kommunaler Ebene,<br />
in Behörden, Kirchengemeinden, Universitäten<br />
und Fachhochschulen zu dieser Thematik. 5<br />
2 Die Enquete-Kommission des<br />
Deutschen Bundestages<br />
Der wohl größte Erfolg des pluralisierungskritischen<br />
Diskurses war die Einrichtung einer<br />
Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages,<br />
die sich 1996 bis 1998 dem Themenkomplex<br />
‚Sogenannte Sekten und Psychogruppen‘<br />
widmete. Ihrem Abschlussbericht (Deutscher<br />
Bundestag, Referat Öffentlichkeitsarbeit 1998;<br />
Deutscher Bundestag, Enquete Kommission<br />
‚Sogenannte Sekten und Psychogruppen‘ 1998)<br />
stimmte die Mehrheit des Deutschen Bundestages<br />
zu; Bündnis 90/Die Grünen verabschiedeten<br />
dazu ein Sondervotum.