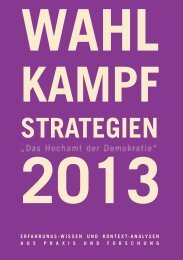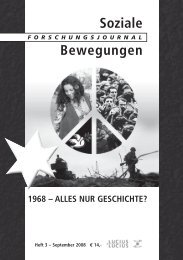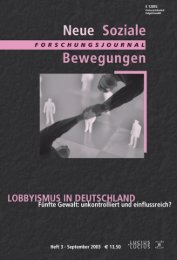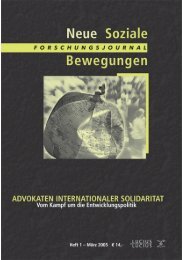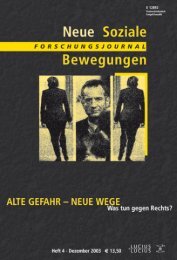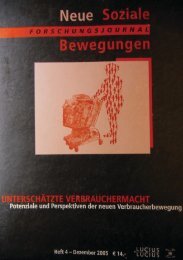Vollversion (1.57 MB) - Forschungsjournal Soziale Bewegungen
Vollversion (1.57 MB) - Forschungsjournal Soziale Bewegungen
Vollversion (1.57 MB) - Forschungsjournal Soziale Bewegungen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Literatur<br />
Politikwissenschaftliche Kategorie<br />
Eva Kreisky legt mit ihrem Beitrag über Geschlecht<br />
als politische und politikwissenschaftliche<br />
Kategorie nicht nur im Buch den Grundstein.<br />
Ihre Person und Arbeit haben manche der<br />
Autorinnen des Bandes ein Stück des Weges<br />
begleitet. Kein Zufall also, dass ihr das Buch<br />
gewidmet ist, als Geburtstagsgeschenk,<br />
vielleicht auch für ihre Geburtshelferinnenschaft<br />
innerhalb der deutschsprachigen frauen- und<br />
geschlechterforschenden Politikwissenschaft.<br />
Ihr Beitrag jedenfalls propagiert geschlechterkritische<br />
Arbeit an Begriffen und stellt ein Plädoyer<br />
für einen wissenschaftstheoretischen Begriff<br />
von Geschlecht dar. Dort knüpft Regina<br />
Dackweiler an, wenn sie die Disziplin nach<br />
Wissenschaftskritik, Methodologie und Methoden<br />
befragt, deren Androzentrismus kritisiert<br />
und die Frauen- und Geschlechterforschung<br />
selbst vor diesem Hintergrund reflektiert. Sabine<br />
Lang widmet sich der für Feministinnen<br />
immer schon zentralen Frage nach den Grenzen<br />
von privat und öffentlich, deren Überschreitung<br />
ja Frauenbewegung und Frauenforschung erst<br />
ermöglicht hat. Macht, Herrschaft und Gewalt<br />
stehen im Zentrum der Auseinandersetzung von<br />
Cornelia Klinger mit diesen Grundbegriffen des<br />
Politischen und Gesellschaftlichen in der politischen<br />
Theorie und deren theoretischer wie praktischer<br />
Relevanz für feministische Debatten.<br />
Birgit Sauer problematisiert die politikwissenschaftliche<br />
Zentralkategorie Staat und stellt die<br />
Frage nach einer aus feministischer Perspektive<br />
Sinn machenden Verortung von Governance in<br />
der zunehmenden Transformation von Staatlichkeit<br />
hin zu globalisierten Steuerungs- und Herrschaftsmechanismen<br />
und nach darin möglichen<br />
frauenpolitischen Interventionen. Barbara Holland-Cunz<br />
wirft Fragen zu Demokratie, Staatsbürgerschaft<br />
und Partizipation auf, die noch lange<br />
nicht zur konsensualen feministischen Zufriedenheit<br />
gelöst sind. Um strukturelle Unterrepräsentanz<br />
von Frauen in politischen Institutionen<br />
und um Repräsentationsforschung geht es<br />
113<br />
bei Sibylle Hardmeier, wobei auch das heftig<br />
umstrittene frauenpolitische Instrument der<br />
Quoten zur Debatte steht. Zwar sind mit den<br />
Konzepten Interesse und Identität pluralistische<br />
Politikformen assoziiert, die sich gerade im<br />
Kontext von Europäisierung und Globalisierung<br />
für die Rezeption frauen- und geschlechterforschender<br />
Erkenntnisse anbieten. Doch bei näherer<br />
Betrachtung durch Sieglinde Rosenberger<br />
wird deutlich, warum gerade deren feministische<br />
Interpretationen in den politikwissenschaftlichen<br />
Mainstream nicht leicht zu integrieren<br />
sind. Ute Behning thematisiert die Geschlechtsspezifik<br />
von Arbeit und Arbeitsteilung als<br />
Grundelement der Ordnung gesellschaftlicher<br />
Verhältnisse und zeichnet deren Debatten nach.<br />
Politik und Recht und die dahinter liegenden<br />
geschlechtszentrierten Paradigmen werden von<br />
Gabriele Wilde analysiert. Um Krieg und Frieden<br />
in den Internationalen Beziehungen geht es<br />
schließlich bei der geschlechterkritschen Betrachtung<br />
durch Cilja Harders, die nach den<br />
Orten von Frauen, aber auch nach der hegemonialen<br />
Maskulinität in und nach feministischen<br />
Gegenentwürfen zu dieser Teildiszplin fragt.<br />
Blick aus dem Zentrum<br />
in das Zentrum<br />
Das Konzept des Bandes spricht eine deutliche<br />
Sprache: Geschlecht dient hier durchwegs nicht<br />
als Bindestrich-Thema, nicht als In-den-Hauptstrom-Bringen<br />
einer möglicherweise verwässerten<br />
Genderei. Geschlecht ist hier explizit<br />
politikwissenschaftliche und politische Kategorie,<br />
die immer noch einiges in Frage stellen kann,<br />
soll und will. Den gemeinsamen Nenner der<br />
Autorinnen bilden der Ansatz der Re- und Dekonstruktion<br />
und die Fokussierung auf einige<br />
wenige zentrale Konzepte, die Betonung ihrer<br />
Verknüpfungen, das Ausleuchten ihrer Kontroversen<br />
und schließlich das Entwickeln von Perspektiven<br />
in der gegenseitigen Rezeption von<br />
Geschlechterforschung und Politikwissenschaft.<br />
Möglicherweise spiegelt dieser Konsens auch