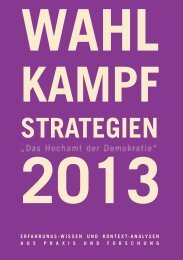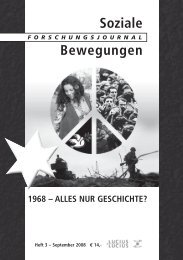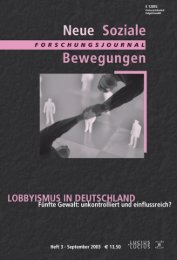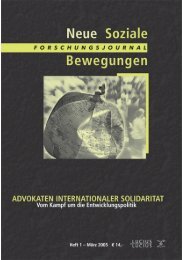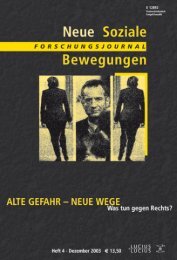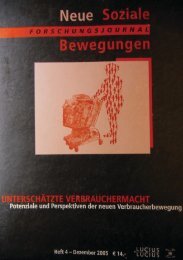Vollversion (1.57 MB) - Forschungsjournal Soziale Bewegungen
Vollversion (1.57 MB) - Forschungsjournal Soziale Bewegungen
Vollversion (1.57 MB) - Forschungsjournal Soziale Bewegungen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Pulsschlag<br />
zu verwirklichen (hm) und die mir och wieder<br />
de Kraft geben, mich auf dem Weg zu halten.“<br />
(Herr H: 1481ff.) Der Theologe Paul Tillich<br />
nennt dieses spezifische Modell christlicher<br />
Weltgestaltung „Geist der Utopie“. Die Vorstellung<br />
einer idealen Gesellschaft hat zwei Dimensionen:<br />
eine innergeschichtliche und eine<br />
übergeschichtliche. Tillich benennt dementsprechend<br />
die zwei grundlegenden Irrtümer: der<br />
„Utopismus“ sucht die Erfüllung ausnahmslos<br />
innergeschichtlich und kann zur totalitären<br />
Paradies-Erzwingung führen, während auf<br />
christlich-religiöser Seite bestimmte Strömungen<br />
die Erfüllung ausschließlich übergeschichtlich<br />
suchen und so jede Veränderung der Welt<br />
auf das Jenseits vertrösten. Den „Geist der<br />
Utopie“ zeichnet aus, dass er um die Gefahren<br />
der beiden Irrtümer weiß und zwischen ihnen<br />
vermittelt. Für Tillich bedeutet dies, dass es<br />
Augenblicke innergeschichtlicher Erfüllung<br />
gibt, dass diese Durchbruchsmomente aber<br />
„nicht das Reich Gottes, sondern das fragmentarische,<br />
vorwegnehmende, immer gefährdete<br />
Bild des Reiches Gottes in einer spezifischen<br />
Periode der menschlichen Geschichte sind“<br />
(Tillich 1963: 156). Diesem Nicht-Drängen auf<br />
Verwirklichung wohnt ein selbstbegrenzendes,<br />
antitotalitäres Element inne. Gerade die Erfahrung<br />
des Scheiterns der großen Gesellschaftsveränderungsprojekte,<br />
das bejubelte oder betrauerte<br />
Ende der Utopien und großen Erzählungen,<br />
macht dieses religiöse Vergegenwärtigungsmodell<br />
so interessant.<br />
Halten wir fest: Eine weitere wichtige Funktion<br />
der Religion ist die Dauermobilisierung<br />
des Engagements trotz zahlreicher Enttäuschungen.<br />
Strategien<br />
Im Folgenden einige Beobachtungen zum Einfluss<br />
der Religion auf die Strategien und Ziele<br />
der Akteure.<br />
Auch hier fördert die Kreativität religiöser<br />
Ideen das Tun-als-ob. Herr H: „wenn ich mich<br />
89<br />
mit’n Schuldirektor auseinandergesetzt hab,<br />
über Wehrerziehung und solche Geschichten,<br />
da bin ich manchmal dann anschließend nach<br />
Hause gekommen und hab mit der (Name der<br />
Ehefrau) drüber gesprochen. Und hab immer<br />
gesagt, äh, ich kann mir vorstellen, dass ich<br />
eines Tages irgendwann, wenn mor im Reich<br />
Gottes sind (...) mit’n Direktor, am Tisch sitz<br />
und wir trinken een Glas Wein und sag´n<br />
Mensch, was war’n wir damals für Arschlöcher,<br />
über welchen Kleinkram ham wir uns<br />
gestritten. Genauso wie wo ich aus’n Knast<br />
rauskam, hab ich zur (Name der Ehefrau) gesagt,<br />
ich kann mir vorstellen, mit mei’m Vernehmer,<br />
der mir’s Leben net leicht gemacht<br />
hat, mit dem een Glas Bier zu trinken“ (Herr<br />
H: 1070ff). Jene eschatologische Totalinklusion<br />
verbindet das christliche Ideal versöhnter<br />
Tischgemeinschaft im Abendmahl und das<br />
Reich Gottes. In diese versöhnte Stammtisch-<br />
Gemeinschaft (man zecht zusammen) wird der<br />
politische Gegner (ungefragt) mit eingeschlossen.<br />
Der Wirklichkeit, der Welt des Alltags<br />
werden kontrastierende „Als-ob“-Eigenschaften<br />
unterstellt (Schütz 1971: 271f). Diese<br />
Konstellation sich überschneidender Wirklichkeitsbereiche<br />
ermöglicht es, den politischen<br />
Gegner zu behandeln, als ob er der imaginierte,<br />
christlich behauptete Menschenbruder wäre.<br />
Sie ermöglicht die zeitweise Distanzierung von<br />
einem Freund-Feind-Schema und damit eine<br />
nicht verbitternde Einstellung gegenüber dem<br />
politischen System.<br />
In der Selbstbeschreibung der Interviewten<br />
wird das eigene Handeln am biblischen Vorbild<br />
der ‚Umkehr’ orientiert. ‚Umkehr’ meint, dass<br />
der Veränderung der Gesellschaft notwendig die<br />
Veränderung des persönlichen Lebensstiles vorausgehen<br />
muss. Herr E: „für eine Veränderung<br />
der Welt (...), dass das beides nur miteinander<br />
gelingen kann, nur wenn Menschen, die selbst<br />
sozusagen auf dem Wege der Veränderung sind,<br />
dass die auch sozusagen auch die Akzeptanz<br />
haben und auch die Kompetenz haben die poli-