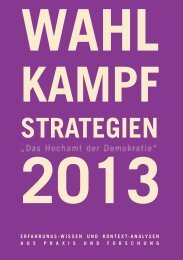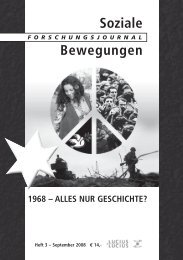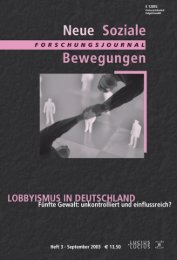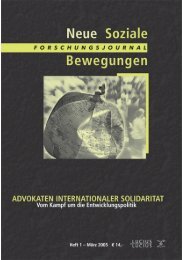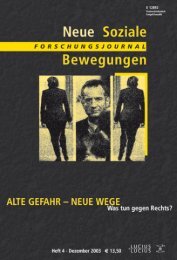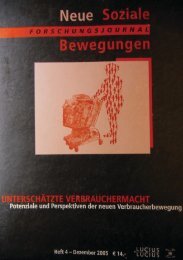Vollversion (1.57 MB) - Forschungsjournal Soziale Bewegungen
Vollversion (1.57 MB) - Forschungsjournal Soziale Bewegungen
Vollversion (1.57 MB) - Forschungsjournal Soziale Bewegungen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
72<br />
sie die abnehmende Bedeutung religiöser Werte<br />
und will dem entgegenwirken. Sie propagiert<br />
Methoden der Selbsthilfe, wird aber auch politisch<br />
aktiv, wenn sich entsprechende Möglichkeiten<br />
bieten.<br />
3 Regulierung und Instrumentalisierung<br />
neuer religiöser <strong>Bewegungen</strong><br />
In den 1990er Jahren durchlebte Japan eine<br />
Phase politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher<br />
Umstrukturierung, in der sich auch<br />
das Verhältnis von Politik und religiösen <strong>Bewegungen</strong><br />
maßgeblich veränderte. Die politischen<br />
Machtverhältnisse änderten sich, die LDP musste<br />
Machtverluste hinnehmen, die Opposition<br />
gewann an Stärke. Als sich entsprechend Risse<br />
in der politischen Ordnung Japans zeigten, versuchten<br />
religiöse <strong>Bewegungen</strong> erneut, diese zum<br />
politischen Einfluss zu nutzen. So bot beispielsweise<br />
die Kôfuku no kagaku der LDP die Unterstützung<br />
mit Wählerstimmen an, gewann<br />
Politiker als Mitglieder und somit Bündnispartner<br />
in der politischen Elite (vgl. Astley 1995:<br />
374).<br />
Insbesondere zwei Ereignisse prägten das<br />
gesellschaftspolitische Klima Japans: Zum einen<br />
der am 20. März 1995 von der Aum verübte<br />
Giftgasanschlag auf die Tokyoter U-Bahn, bei<br />
dem zwölf Menschen ums Leben kamen und<br />
über 5.000 verletzt wurden. Zum anderen das<br />
von der LDP im Herbst 1999 geschlossene<br />
Regierungsbündnis mit der Neuen Kômeitô,<br />
hinter der die buddhistisch geprägte Religionsgemeinschaft<br />
Sôka Gakkai steht. Durch diese<br />
beiden Ereignisse trat zum ersten Mal in der<br />
japanischen Nachkriegsgeschichte die Frage<br />
nach einer angemessenen staatlichen Kontrolle<br />
bei gleichzeitiger Bewahrung der Religionsfreiheit<br />
in den Mittelpunkt öffentlicher Debatten.<br />
Nachdem durch die bis in die 1990er Jahre starren<br />
politischen Gelegenheitsstrukturen lediglich<br />
direkte politische Aktivitäten religiöser <strong>Bewegungen</strong><br />
eingeschränkt waren, sind seit dem At-<br />
tentat der Aum die Einflussmöglichkeiten religiöser<br />
<strong>Bewegungen</strong> generell durch direkte staatliche<br />
Kontrollmaßnahmen und ein anti-religiöses<br />
Klima reglementiert.<br />
3.1 Der Giftgasanschlag der Aum<br />
Shinrikyô<br />
Iris Wieczorek<br />
Der Giftgasanschlag hat in Japan ein Trauma<br />
ausgelöst, das bis heute nicht verarbeitet ist. Er<br />
hat zu erheblicher Verunsicherung und zu einem<br />
massiven Vertrauenseinbruch gegenüber<br />
dem staatlichen Apparat geführt. Die japanische<br />
Öffentlichkeit, tief schockiert über das Ausmaß<br />
der kriminellen Aktivitäten, versuchte zunächst,<br />
die Aum als nicht-japanisches Phänomen abzutun.<br />
Doch sie war in Japan entstanden und ihre<br />
10.000 Mitglieder waren Japaner. Zudem teilte<br />
Aum zahlreiche Charakteristika der neuen religiösen<br />
<strong>Bewegungen</strong>, und wurde in der wissenschaftlichen<br />
Diskussion wie in den Medien als<br />
eine typisch japanische religiöse Bewegung angesehen<br />
(Shimazono 2001).<br />
In der öffentlichen Auseinandersetzung wurden<br />
verschiedene soziale Missstände erstmals<br />
konkret thematisiert: die Unfähigkeit der etablierten<br />
Religionen, die spirituellen Bedürfnisse<br />
der japanischen Jugend zu befriedigen; das Versagen<br />
des Erziehungssystems, seinen Schülern<br />
die Fähigkeit zum analytischen Denken zu vermitteln;<br />
die japanische Arbeitsethik sowie die<br />
Zwänge des wenig flexiblen Arbeitssystems;<br />
die übermäßige Betonung des Materialismus in<br />
der japanischen Konsumgesellschaft. All dies<br />
habe laut Journalisten und Politikern ein spirituelles<br />
Vakuum in Japan hinterlassen und viele<br />
Jugendliche auf der Suche nach einer alternativen<br />
Lebensweise in die Hände von Manipulatoren<br />
wie Asahara, der sich selbst als Messias<br />
sah, getrieben. Der Giftgasanschlag wird bis<br />
heute mit einfachen Deprivationskonzepten<br />
(Unzufriedenheit mit der Gesellschaft, Gehirnwäsche<br />
und ein geistesgestörter Gründer, Asahara)<br />
erklärt, die das religiöse, politische und