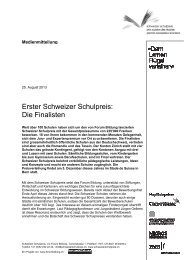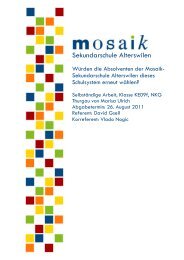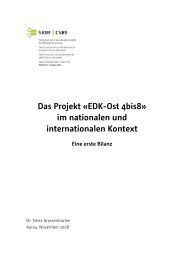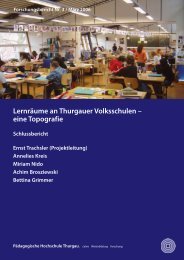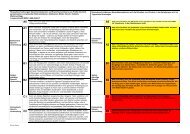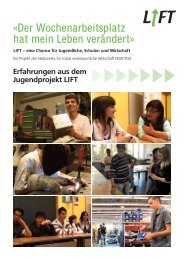Grundlagenstudie FBBE - Finalversion (edit 13032009 ...
Grundlagenstudie FBBE - Finalversion (edit 13032009 ...
Grundlagenstudie FBBE - Finalversion (edit 13032009 ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Grundlagenstudie</strong><br />
4 Die Praxis der <strong>FBBE</strong> Schweiz: Organisation, Angebote<br />
und Personal<br />
In der Schweiz werden Kinder je nach Alter<br />
und Angebotsform entweder dem Frühbereich<br />
(0 bis 4 Jahre) oder dem Vorschulbereich<br />
(4 bis 6 Jahre) zugeteilt. Eine Ausnahme<br />
bildet der Kanton Tessin, wo Kinder Angebote<br />
im Vorschulbereich bereits ab dem<br />
vollendeten dritten Lebensjahr besuchen<br />
dürfen. Überblickt man die Gesamtentwicklung<br />
in der Schweiz, so zeigen sich unterschiedliche<br />
Paradigmen zwischen den einzelnen<br />
Sprachregionen. Während in der<br />
deutschen Schweiz bislang in erster Linie<br />
Pestalozzi und Fröbel als Leitfiguren galten<br />
und in Folge dessen eine explizite Sozialorientierung<br />
mit freiem Spiel und ganzheitlicher<br />
Förderung in Abgrenzung zur kognitiven<br />
Förderung im Mittelpunkt stand, dominierte<br />
in der Romandie in Anlehnung an das<br />
englische Modell der infant school und unter<br />
Inspiration von Claparède und Piaget die<br />
schulvorbereitende, kognitiv orientierte<br />
Funktion vorschulischer Förderung. Eine<br />
ähnliche, allerdings spezifisch an Montessori<br />
(Material), Fröbel (Spiel) und den Geschwistern<br />
Agazzi (didaktische Prinzipien) orientierte<br />
Ausrichtung verfolgten vorschulische<br />
Institutionen im Tessin. Diese Entwicklungen<br />
haben dazu geführt, dass dem Kindergarten<br />
der deutschen Schweiz vorwiegend<br />
eine sozialpädagogische, der école enfantine<br />
der Romandie und auch der scuola<br />
dell'infanzia eine kognitiv-schulvorbereitende<br />
Funktion zugesprochen wird. Diese Paradigmen<br />
spiegeln sich auch in der internationalen<br />
Perspektive: So findet sich das kognitiv-schulvorbereitende<br />
Paradigma in Ländern<br />
wie Frankreich, England oder den Niederlanden<br />
wieder, während das sozialpädagogisch<br />
orientierte Paradigma in Österreich,<br />
Deutschland, Schweden oder Dänemark<br />
grundlegend ist. Heute zeichnet sich in<br />
der Schweiz, aber auch international, die<br />
Tendenz ab, die beiden Paradigmen – Sozia-<br />
34<br />
lisationsfunktion einerseits und Bildungsfunktion<br />
andererseits – miteinander zu<br />
kombinieren. Dies kommt exemplarisch im<br />
neuen Schuleingangsmodell der Grund-/Basisstufe<br />
zum Ausdruck, einem Schulentwicklungsprojekt,<br />
das Kindergarten sowie erste<br />
Klasse («Grundstufe») respektive Kindergarten<br />
sowie erste und zweite Klasse («Basisstufe»)<br />
zu einer einzigen Stufe vereint. Aber<br />
auch seitens der familienergänzenden Betreuungspraxis<br />
wird zunehmend ein Paradigmenwechsel<br />
gefordert, weg vom Verständnis<br />
als Dienstleistung für erwerbstätige<br />
Eltern hin zur ganzheitlichen Lern- und Entwicklungsförderung<br />
des Kleinkindes.<br />
Inwiefern es in der Schweiz gelingt, diese<br />
beiden Paradigmen zusammenzubringen,<br />
dürfte eine grosse Herausforderung werden.<br />
Sie besteht darin, zwischen den unter<br />
der Kontrolle der Sozial- und Gesundheitsbehörden<br />
(und damit der SODK) stehenden<br />
Betreuungsangeboten und den Bildungsangeboten,<br />
die den Schulbehörden (und damit<br />
der EDK) zugeordnet sind, einen gemeinsamen<br />
Verantwortungsbereich zu schaffen.<br />
Diese Forderung bildet das Herzstück des<br />
Starting Strong II-Berichts der OECD (2006),<br />
die einen zusammenhängenden, Synergien<br />
schaffenden Bildungs- und Betreuungsraum<br />
fordert. Nicht gerade zuversichtlich stimmt<br />
deshalb die gemeinsame Erklärung von EDK<br />
und SODK, in der die Aufgliederung der beiden<br />
Bereiche festgeschrieben wird und die<br />
SODK zukünftig die Zuständigkeiten für den<br />
Frühbereich (0 bis 4/5 Jahre) und die EDK<br />
(ab dem vollendeten vierten Lebensjahr) die<br />
Verantwortung für die obligatorische Schule<br />
erhält. Es wird sich somit erweisen, ob dadurch<br />
die historisch bedingten unterschiedlichen<br />
Traditionen weiter zementiert oder<br />
neue Synergien geschaffen werden, welche<br />
die Schweiz auch international anschlussfähig<br />
machen.