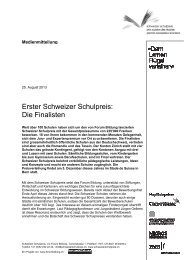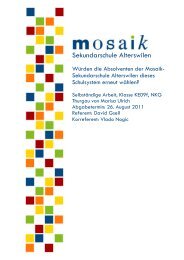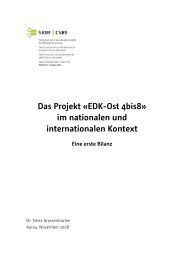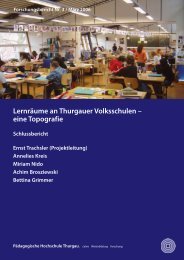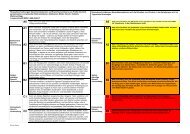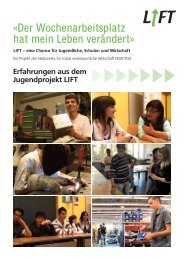Grundlagenstudie FBBE - Finalversion (edit 13032009 ...
Grundlagenstudie FBBE - Finalversion (edit 13032009 ...
Grundlagenstudie FBBE - Finalversion (edit 13032009 ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Grundlagenstudie</strong><br />
7 Die Grund-/Basisstufe und ihre <strong>FBBE</strong>-Verknüpfungen<br />
Grundlagen und Ziele des Projekts<br />
In neun Kantonen der Deutschschweiz (AG,<br />
BE, GL, FR, NW, LU, TG, SG und ZH) und im<br />
Fürstentum Liechtenstein werden zwischen<br />
2003 und 2009 Schulversuche zur Grund-/<br />
Basisstufe durchgeführt. Das Projekt trägt<br />
das Kürzel «Projekt EDK-Ost 4bis8». Grundlage<br />
für die Lancierung dieser Schulversuche<br />
im Jahr 2002 bildete die Tatsache, dass<br />
der bis anhin praktizierte Schuleintritt den<br />
unterschiedlichen Lern- und Entwicklungsständen<br />
der Kinder nicht mehr entspricht.<br />
Im Mittelpunkt des Projekts steht die Erprobung<br />
zweier Schuleingangsmodelle für<br />
vier- bis achtjährige Kinder in 160 Schulversuchsklassen:<br />
der Grundstufe und der Basisstufe.<br />
Alle deutsch- und gemischtsprachigen<br />
Kantone sowie das Fürstentum<br />
Liechtenstein arbeiten mit, unabhängig davon,<br />
ob sie selbst Schulversuche durchführen<br />
oder nicht. Es handelt sich um eine<br />
pädagogische und organisatorische Neukonzeption<br />
der Schuleingangsstufe. Die<br />
dreijährige Grundstufe umfasst zwei Kindergartenjahre<br />
und die erste Klasse der Primarschule,<br />
in der vierjährigen Basisstufe<br />
werden zwei Kindergartenjahre und die<br />
beiden ersten Klassen der Primarschule zusammengefasst<br />
und gemeinsam unterrichtet.<br />
Die Motive für die Konzeption dieser<br />
neuen Schuleingangsstufe waren vielfältig:<br />
Beispielsweise wurde erkannt, dass Kinder<br />
heute früher beginnen, ihre Kompetenzen<br />
zu entwickeln und in ihren Lernfähigkeiten<br />
lange unterschätzt worden sind sowie ein<br />
Anteil von gut 20% der Kinder die Lernziele<br />
der ersten Klasse bereits bei Schuleintritt<br />
erreicht hat (Stamm, 2005). Auch die neurobiologische<br />
und entwicklungspsychologische<br />
Forschung verweist auf das grosse<br />
Entwicklungspotenzial junger Kinder (Fried,<br />
2008; Becker-Stoll, 2008; Viernickel & Simoni,<br />
2008), aber ebenso auf deren enor-<br />
78<br />
me Entwicklungsunterschiede (Largo,<br />
1999). Entsprechend konnte auch eindrücklich<br />
nachgewiesen werden, dass sich<br />
Lernausgangslagen von jungen Kindern bei<br />
Eintritt in den Kindergarten (Stamm,<br />
2004a) sowie am Anfang ihrer Schulzeit<br />
(Moser, Stamm & Hollenweger, 2005)<br />
deutlich unterscheiden. Schliesslich ist hinlänglich<br />
bekannt, dass ein beträchtlicher<br />
Teil bei Schuleintritt zurückgestellt oder<br />
Einschulungsklassen zugeteilt wird (Schweizerische<br />
Koordinationsstelle für Bildungsforschung,<br />
2006; Lanfranchi, 2007).<br />
Die Modellelemente präsentieren sich im<br />
fliessenden Übergang vom Spiel zum Lernen,<br />
in der Altersdurchmischung der Lerngruppen,<br />
im individualisierten, integrativen<br />
Unterricht mit fähigkeits-, interessen- und<br />
entwicklungsorientiertem Beginn des Erwerbs<br />
der Kulturtechniken sowie in den<br />
unterschiedlichen Durchlaufzeiten. Ein<br />
multiprofessionell arbeitendes Team (Kindergarten-<br />
und Lehrperson, zeitweise heilpädagogische<br />
Fachperson) setzt diese Modellelemente<br />
um. Ein wesentliches Ziel der<br />
Grund-/Basisstufe liegt darin, den unterschiedlichen<br />
Startchancen aller Kinder gerecht<br />
werden und so zum Ausgleich sozialer<br />
Ungleichheiten beitragen.<br />
Das Projekt wird derzeit wissenschaftlich<br />
ausgewertet. Die formative Evaluation erfolgt<br />
dabei durch das Institut für Lehr- und<br />
Lernforschung der Pädagogischen Hochschule<br />
des Kantons St. Gallen, die summative<br />
Evaluation durch das der Universität Zürich<br />
assoziierte Institut für Bildungsevaluation.<br />
Während die formative Evaluation als<br />
Längsschnittbefragung bei Eltern und Lehrpersonen<br />
angelegt ist, untersucht die summative<br />
Evaluation die Lernfortschritte der<br />
Kinder. Dabei werden die Grundstufe und<br />
die Basisstufe mit dem herkömmlichen<br />
Modell von zwei Jahren Kindergarten und<br />
der Primarschule verglichen. Das Projekt