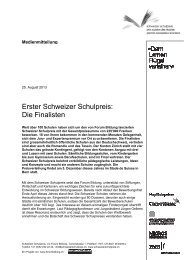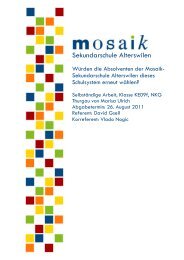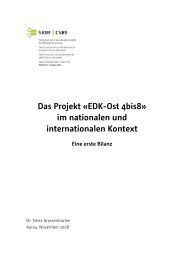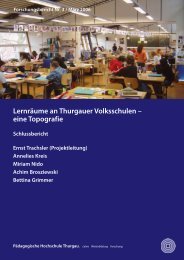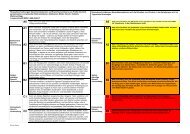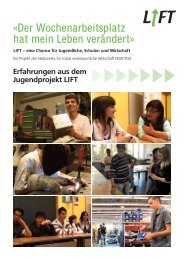Grundlagenstudie FBBE - Finalversion (edit 13032009 ...
Grundlagenstudie FBBE - Finalversion (edit 13032009 ...
Grundlagenstudie FBBE - Finalversion (edit 13032009 ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Grundlagenstudie</strong><br />
Tab. 5.1: Kinderarmut in der Schweiz im ausgewählten internationalen Vergleich im Jahr<br />
2000 (OECD, 2007)<br />
Staat Anteil in %<br />
Dänemark 2.4<br />
Finnland 3.4<br />
Norwegen 3.6<br />
Schweden 3.6<br />
Belgien 4.1<br />
Schweiz 6.8<br />
Tschechien 7.2<br />
Niederlande 9.0<br />
Deutschland 12.8<br />
Österreich 13.3<br />
Kanada 13.6<br />
Italien 15.7<br />
USA 21.6<br />
Mexiko 24.8<br />
OECD 12.0<br />
Kinderarmut war in der Schweiz bislang<br />
eher ein Tabuthema. Gerade weil ihr Kinder<br />
später als Erwachsene selten entkommen,<br />
muss das erste Ziel darin liegen, den<br />
Anteil einkommensschwacher Kinder zu reduzieren.<br />
Auf die enorme Bedeutung früher<br />
Bildungsförderung für von Armut betroffene<br />
Kinder verweisen viele neuere Untersuchungen.<br />
Auch die EKKJ (2007) betont,<br />
dass nachteilige Auswirkungen von<br />
Kinderarmut nicht monokausal auf ökonomische<br />
Knappheit zurückzuführen sind,<br />
sondern das Resultat eines komplexen Zusammenspiels<br />
verschiedener personaler,<br />
sozialer und institutioneller Bedingungen<br />
darstellen. Ein gutes <strong>FBBE</strong>-Angebot ermöglicht<br />
Kindern Erlebnisbereiche und Handlungen<br />
unabhängig von finanziellen Ressourcen<br />
und kann auf diese Weise Defizite<br />
im familiären Bereich zumindest teilweise<br />
kompensieren. Dass eine kompensatorische<br />
Förderung erfolgreich sein kann, belegen<br />
die amerikanischen Head Start Programme<br />
eindrücklich.<br />
56<br />
Kinder mit Migrationshintergrund<br />
Mehr als die Hälfte der Neugeborenen in<br />
der Schweiz hat mindestens einen ausländischen<br />
Elternteil (BfS/SAKE, 2005). Allerdings<br />
gelten diese Kinder nicht automatisch alle<br />
als benachteiligt, weil ihre familiären Ausgangsbedingungen<br />
sehr unterschiedlich<br />
sind. Neben Erziehungsberechtigten mit<br />
hochqualifizierender Ausbildung gibt es<br />
nicht qualifizierte Eltern ohne postobligatorische<br />
Ausbildung. Während erstere als<br />
«Motor des Schweizer Wirtschaftswachstums»<br />
bezeichnet werden (Kummels, 2007),<br />
gelten letztere als Personen, die überproportional<br />
stärker von Arbeitslosigkeit bedroht<br />
sind als Menschen ohne Migrationshintergrund.<br />
Es versteht sich deshalb von<br />
selbst, dass ein ‚Migrationshintergrund’<br />
nicht automatisch mit sozialer Benachteiligung<br />
gleich gesetzt werden kann. Dies betont<br />
auch Lanfranchi (2002;2007) mit Verweis<br />
auf bildungsnahe Einwandererfamilien<br />
mit gutem sozioökonomischen Status. In<br />
Folge dessen existiert weder eine klare Definition,<br />
wann ein Kind aufgrund seines Migrationsstatus<br />
benachteiligt ist, noch verfü-