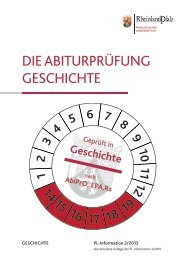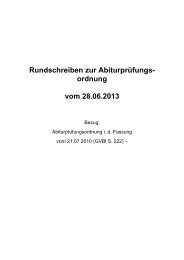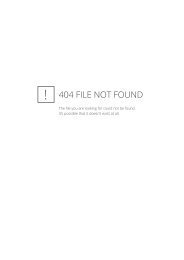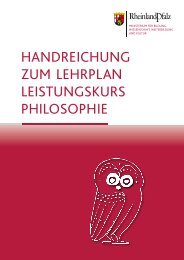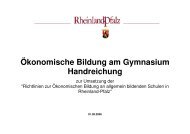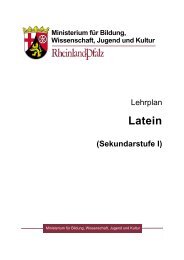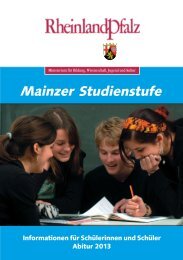handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Entstehung des Alls“ (Aristoteles: Metaphysik, Buch<br />
I, Kapitel 2). Ziel des durch das Staunen aus gelösten<br />
Fragens ist das Wissen von „den ersten Prinzipien und<br />
Ursachen“ des Seins.<br />
Den hohen Stellenwert behält das Staunen bis in<br />
die moderne Philosophie. Ernst Bloch <strong>zum</strong> Beispiel<br />
bringt in der Tübinger Einleitung in die Philosophie I<br />
im Abschnitt Das fragende Stau nen das im Kindesalter<br />
beginnende Staunen mit der „Kinderfrage“ in Zusammenhang<br />
„Wa rum ist etwas und nicht nichts?“ – für<br />
Heidegger die Grundfrage der Metaphysik. Andere<br />
Fragen, die Ernst Bloch erwähnt, sind <strong>zum</strong> Beispiel:<br />
„Was ist die Zeit?“ oder die dem Staunen darüber,<br />
dass es regnet, entspringende „Frage: wie entsteht<br />
Regen?“. Man möchte als Le ser von Blochs Ausführungen<br />
<strong>zum</strong> kindlichen Fragen die Kinderfragen aus<br />
Peter Handkes Lied Vom Kindsein hinzufügen: „Wo<br />
endet der Raum? Ist das Leben unter der Sonne nicht<br />
bloß ein Traum?“. Diese Kinderfragen sind für Bloch<br />
„Grundfragen der Existenz selber“. Bloch bringt das<br />
„fra gende Staunen“ in Zusammen hang mit der Sprachlosigkeit,<br />
die den staunenden Menschen überfallen<br />
kann, und dem klassi schen Dokument von Sprachlosigkeit<br />
und Sprachkrise, dem Chandos-Brief Hugo von<br />
Hof mannsthals. Nach Bloch erliegt Lord Chandos<br />
dem Staunen über die unscheinbaren Dinge. Folge<br />
davon ist die Unfähigkeit von Lord Chandos, die abstrakten<br />
Begriffe zu benutzen, diese zerfallen ihm „im<br />
Munde wie modrige Pilze“. Für Bloch rührt die Sprachkrise<br />
von Lord Chandos daher, dass im „sprachlich<br />
übereilten und verabre deten Fortgang“ der Rede „das<br />
Staunen unter schlagen wird“. Die Existenz<strong>philosophie</strong><br />
von Karl Jaspers verbindet den Ursprung der Philosophie<br />
mit dem Begriff der Grenzsituation. Grenzsituationen<br />
versteht Jaspers als „Situationen, über die wir<br />
nicht hinauskommen“ und die die „Grenze“ von Dasein<br />
offenbaren, also Situationen wie <strong>zum</strong> Beispiel Leid<br />
oder die Erfahrung von Schuld. In ihnen erfährt sich<br />
die Existenz als Existenz, die für Jaspers im Akt eigentlicher<br />
Kommunikation auf andere Existenz ausgerichtet<br />
ist. „So gilt: der Ursprung der Philosophie liegt zwar<br />
im Sichverwundern, im Zweifel, in der Erfah rung der<br />
Grenzsituation, aber zuletzt dieses alles in sich schließend,<br />
in dem Willen zur eigent lichen Kommunikation“<br />
(Karl Jaspers: Was ist Philosophie?).<br />
Denker wie Max Scheler (Die Stellung des Men schen<br />
im Kosmos) und Martin Heidegger (Was ist Metaphysik?)<br />
stellen einen Zusammen hang her zwischen<br />
der Erfahrung des Nichts und der Erfahrung des Seins.<br />
Nach Scheler folgt aus dem Gefühl des „Erschauerns“<br />
vor dem Nichts eine Demutshaltung, die sich in bejahender<br />
Weise mit dem Sein verbunden fühlt. Nach<br />
Heidegger kennzeichnet der zentrale Begriff der Angst<br />
diejenige Stimmung, die das Nichts im Grunde des<br />
Daseins of fenbart. Im 1943 erstmals veröffentlichten<br />
Nachwort zur Antrittsvorlesung schreibt Heidegger:<br />
„Die Be reitschaft zur Angst ist das Ja zur Inständigkeit,<br />
den höchsten Anspruch zu erfüllen, von dem allein das<br />
Wesen des Menschen getroffen ist. Einzig der Mensch<br />
unter allem Seienden erfährt, angerufen von der Stimme<br />
des Seins, das Wunder aller Wunder: dass Seiendes<br />
ist.“ Nach den Ausführungen in Sein und Zeit gewinnt<br />
das Dasein dadurch, dass es sich als ein „Sein <strong>zum</strong><br />
Tode“ versteht, seine „Eigentlichkeit“, die Voraussetzung<br />
ist für die Offenheit des Seins (Martin<br />
Heidegger: Sein und Zeit).<br />
„Irren mag menschlich sein, aber Zweifeln ist menschlicher,<br />
indem es gegen das Irren an geht, das ausruht“,<br />
schreibt Bloch in der Tübinger Einleitung in die<br />
Philosophie I (Zweifel an den Sin nen und Gedanken).<br />
Für Bloch liegt der Wert des zweifelnden Misstrauens<br />
darin begründet, dass es „mit dem Tabu bisherig-fester<br />
Meinungen“ bricht. Fruchtbar für den Er kenntnisfortschritt<br />
in Wissenschaft und Philosophie ist nach<br />
Bloch das „methodische Zwei feln“, das „am fragwür<br />
dig Geschehenen neues Frag-Würdiges entdeckt“,<br />
nicht der radikale Zweifel, der in lähmender Skepsis<br />
oder Nihilismus mündet. Als Prototyp des methodischen<br />
Zweifelns gilt Bloch der „carte sianische Rat<br />
des fruchtbaren Zweifelns an allem, um desto wahrer<br />
daraus aufzutauchen“. Auch wenn der cartesianische<br />
Zweifel, der in der Ersten Me ditation geschildert<br />
wird, existenzielle Un ruhe <strong>zum</strong> Ausdruck bringt, so<br />
ist doch das erklärte Ziel die Etablierung von Gewissheit,<br />
mit der das Fundament gelegt werden kann für<br />
wissen schaftliche Erkenntnis, wie der erste Satz des<br />
Textes programmatisch artikuliert: „Schon vor Jahren<br />
bemerkte ich, wie viel Falsches ich von Jugend auf als<br />
wahr hingenommen habe und wie zweifelhaft alles<br />
sei, was ich später darauf gründete; darum war ich der<br />
Meinung, ich müsse einmal im Leben von Grund auf<br />
alles um stürzen und von den ersten Grundlagen an ganz<br />
neu anfangen, wenn ich später einmal etwas Festes und<br />
Bleibendes in den Wis senschaften errichten wollte.“<br />
8<br />
Einführung in die Philosophie