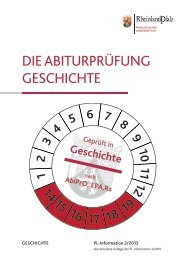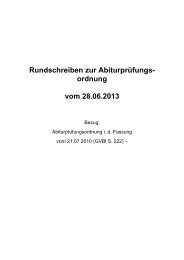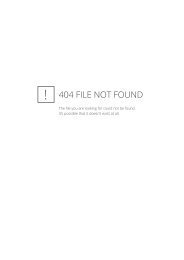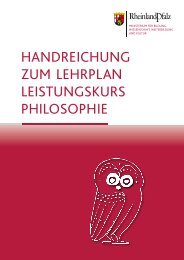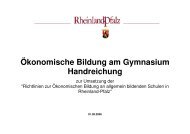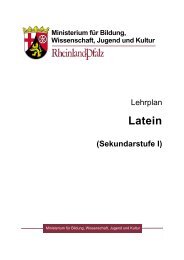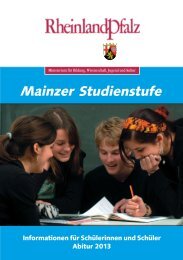handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
. Polis contra Kosmopolis –<br />
Die antike „Weltvernunft“<br />
Der Grundgedanke der stoischen Philosophie, die<br />
auch in ihrer Spätphase noch von dem römischen<br />
Kaiser Marc Aurel vertreten wird, liegt in der Vorstellung<br />
einer ordnenden Ur sache allen Seins, dem<br />
Logos als Weltvernunft (Marc Aurel: Medita tionen<br />
1, 20; 9,16). Somit geschieht nichts zufällig, sondern<br />
unterliegt den kosmischen Ge setzen. Der Mensch,<br />
der als Vernunftwesen Einsicht in die Weltvernunft<br />
nehmen kann, ist somit in der Lage, sein Leben, auch<br />
das in politischen Gemeinschaften, zur Glückseligkeit<br />
zu bringen, indem er vernünftig, d. h. in Übereinstimmung<br />
mit der Natur handelt (Marc Aurel:<br />
Meditationen 3,12). Erkenntnis der Weltvernunft ist<br />
durch empirische Erfahrungen, durch sinnliche Wahrnehmung<br />
möglich, dennoch kann die Vernunft durch<br />
Affekte beirrt werden, etwa durch (Un)Lust, Begierde<br />
und Furcht, was zu Fehlverhalten, ja zu Rechtsbrüchen<br />
füh ren kann und selbst beim Rechtsbrecher körperliche<br />
und seelische Schäden verursacht. Weltvernunft<br />
und Weltgesetz gelten unabhängig von einzelnen<br />
Rechtsgrundsätzen einzelner Staaten, sie gelten für<br />
alle Völker und alle Staaten für alle Zeiten, überdauern<br />
alle Epochen und sollen die Grundlage für alle<br />
staatlichen Rechtsnormen bilden. Dem Menschen,<br />
der als Teil des kosmischen Ganzen angesehen wird,<br />
kommt Gleichheit zu, was sich u. a. in der Ablehnung<br />
der Sklavenhaltung äußert (Marc Aurel: Meditationen<br />
7,7; 7,9). Aus stoischer Sicht ist es notwendig, einen<br />
Weltstaat zu errichten, um den Logos, die Weltvernunft,<br />
durch einheitliche Gesetze zur vollen Geltung<br />
kommen zu lassen.<br />
c. Der Einbruch des Christentums in<br />
die antike Welt<br />
Im Jahr 391 n. Chr. wird das Christentum zur Staatsreligion<br />
erhoben. Das kulturelle Erbe, ob von Griechen,<br />
Römern oder Germanen, erfährt in den folgenden<br />
Jahrhunderten eine zu nehmend christliche Überformung.<br />
Die klassischen Kardinaltugenden erfahren<br />
eine Ver änderung durch die christlichen Tugenden<br />
„Glaube, Liebe, Hoffnung“ (Thomas von Aquin). Der<br />
Kosmos, das Kreisen der Gestirne, die Vorstellung von<br />
Wiederkehr wird abgelöst von der Vorstellung einer<br />
zeitlich begrenzten Geschichte auf Erden und der<br />
Auferstehungs hoffnung. Das Denken ist christlichtheologisch<br />
durchdrungen: Der Ursprung des Menschen<br />
als Geschöpf Gottes liegt im Paradies. Von dort<br />
wurde er aufgrund der Erbsünde von Gott vertrieben<br />
und muss nun im irdischen Dasein, einer Zeit der<br />
Prüfung, sich zu Gott hin wendend die Entwicklung<br />
<strong>zum</strong> Guten vorantreiben.<br />
So hat Aurelius Augustinus in seinen Confessiones<br />
im XI. Buch die Flüchtigkeit der Zeit und damit deren<br />
Nichtigkeit dargelegt und somit die Vergänglichkeit<br />
im irdischen Leben be tont. Sein Werk Vom Gottesstaat<br />
zeigt zwei Reiche auf, die sich im Geschichtsverlauf<br />
in ste tiger Auseinandersetzung befinden: „civitas<br />
terrena“ und „civitas Dei“. Diese beiden Reiche zeigen<br />
weniger die Beziehung der Menschen untereinander<br />
auf als vielmehr diejenige der Menschen zu Gott<br />
(Aurelius Augustinus: Vom Gottesstaat V, 17). Dabei<br />
umfasst die „civitas Dei“ diejenigen, die wie Adams<br />
Sohn Abel ihre Herzen Gott zuwenden, und die „civitas<br />
terrena“ diejenigen, welche wie Adams Sohn Kain<br />
selbstsüchtig die eigenen Interessen verfolgen (ebd.<br />
XIV, 13). Augustinus’ Blick ist auf das Jenseits gerichtet;<br />
die Lösung politischer Fragen steht weniger im<br />
Zentrum seiner Reflexion, vielmehr kommt es darauf<br />
an, dass der Einzelne sein Leben nach Gottes Willen<br />
ausrichtet, ganz gleich, unter welcher staatlicher<br />
Herrschaft er lebt. Augustinus ist ein engagierter<br />
Verfechter des Christentums; boshaft blickt er auf die<br />
Juden, die er kur<strong>zum</strong> zu „Feinden“ der Kirche er klärt.<br />
Augustinus fordert vom weltlichen Staat Friede und<br />
Unversehrtheit des rechten Glau bens, was notfalls<br />
auch durch einen gerechten Krieg sichergestellt<br />
werden muss (ebd. XIX, 15).<br />
3. Vertragstheorien:<br />
Vertragstheorien sind im Wesentlichen durch folgende<br />
Grundmerkmale gekennzeichnet: Sie verweisen auf<br />
eine soziale Ausgangssituation, einen „Ur-“ oder<br />
„Naturzustand“ ohne Institu tionen und Regeln. Dieser<br />
Verweis kann entweder als historische Annahme eines<br />
tatsäch lichen Zustands oder aber auch als ein Gedankenexperiment<br />
gemeint sein. Aufgrund der schlechten<br />
sozialen Bedingungen, die diesem Naturzustand innewohnen,<br />
schließen in dieser Annahme die Beteiligten<br />
Politische Philosophie – Rechts<strong>philosophie</strong> 103