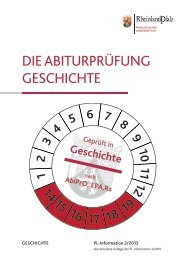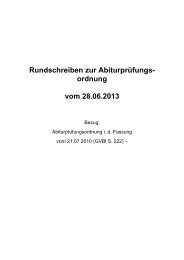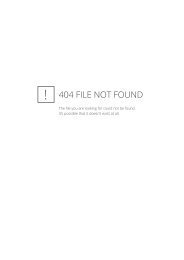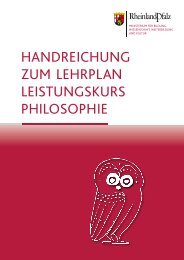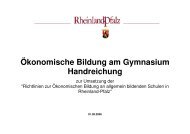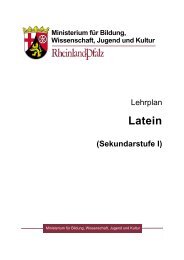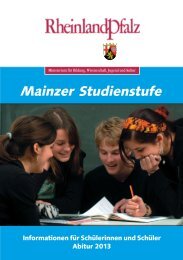handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Methode der Induktion auf der Basis einer empiristischen<br />
Erkenntnistheo rie explizit begrün det zu<br />
haben (Francis Bacon: Novum organon scientiarum).<br />
Voraus setzung wissenschaftlichen Erkennens ist nach<br />
Bacons Idola-Lehre zunächst die Besei tigung von<br />
falschen Vorstellungen, Irrtümern und Vorurteilen.<br />
Grundsätzlich ist es nach Bacon möglich, ausgehend<br />
von der Sin neswahr nehmung eine Erkenntnis<br />
der Natur gesetze zu erlangen. Im Mittelpunkt des<br />
induktiven Verfahrens steht das Experiment, das<br />
methodisch über die bloße Naturbeobachtung hinausgeht,<br />
weil im Kontext des Ex periments variable<br />
Größen gezielt verändert werden können. Der Abstraktionsprozess<br />
vollzieht sich in Zwischenschritten<br />
(Tafelmethode), in denen bestimmte Ein flussgrößen<br />
ausgeschlossen werden sollen. Voraussetzung für<br />
Bacons methodische Überle gungen ist neben dem<br />
Empirismus eine realistische Grundüberzeugung, die<br />
es erlaubt, das All gemeine der Erfahrung durch Abstraktion<br />
erzielen zu können. In Kontrast dazu steht<br />
der skepti zistisch geprägte Empirismus David Humes,<br />
der die Möglichkeit, allgemeingültige Gesetze durch<br />
Erfahrung zu finden, infrage stellt. Die Konsequenz<br />
dieses Skeptizis mus besteht darin, dass allgemeingültige<br />
Aussagen überhaupt nicht mehr möglich sind,<br />
sondern nur noch Aussagen, die Korrelationszusammenhänge<br />
aufweisen. Im 20. Jahr hundert verbindet<br />
man mit induktiver Wis senschaftstheorie u. a. den<br />
logischen Empiris mus des Wiener Kreises (Moritz<br />
Schlick, Otto Neurath, Rudolf Carnap), die in den<br />
Anfängen ihrer Überlegungen von der Infallibilität<br />
wissenschaftlicher Erkenntnis ausgehen. Sinnvolle<br />
Sätze sind entweder analytische Sätze der Logik und<br />
der Mathe matik oder Beobachtungssätze (Protokollsätze),<br />
sinnlose Sätze hingegen Sätze der Metaphysik.<br />
Im Gegensatz zur induktiven Methode steht die sich<br />
im Verlauf des 19. Jahrhunderts herausbildende hypothetisch-deduktive<br />
Methode, bei der prinzipiell frei<br />
wählbare Hypothesen in einem deduktiven Überprüfungsverfahren<br />
auf ihre Konsequen zen hin beleuchtet<br />
werden, wie Karl Popper, der als wichtigster Vertreter<br />
dieser Me thode gilt, ausführt: „Aus der vorläufig unbegründeten<br />
Antizipation, dem Einfall, der Hypothese,<br />
dem theoretischen System, werden auf logisch-deduktivem<br />
Weg Folgerun gen abgeleitet; diese werden untereinander<br />
und mit anderen Sätzen verglichen, indem<br />
man feststellt, welche logischen Beziehungen (z. B.<br />
Äqui valenz, Ableitbarkeit, Vereinbar keit, Widerspruch)<br />
zwischen ihnen bestehen“ (Karl Popper: Die wissenschaftliche<br />
Me thode). Der kritische Rationalismus<br />
Poppers postuliert neben dem Falsifi kationsprinzip<br />
die Fallibilität von wissenschaftlichen Erkenntnissen.<br />
Obwohl Popper auf der Ba sis eines erkenntnistheoretischen<br />
Realismus von der Erkennbarkeit der Welt<br />
ausgeht, ist dieser (wissenschaftliche) Erkenntnisprozess<br />
unabschließbar, hypo thetisch, ohne apo diktische<br />
Ge wissheit, was sich unter anderem darin ausdrückt,<br />
dass eine Verifizierung von Aussagen auf der Basis von<br />
Beobachtungen nach Popper (Logik der For schung)<br />
nicht möglich ist; es wird somit in der wissenschaftstheoretischen<br />
Konzeption Poppers ausgeschlossen,<br />
auf der Ba sis der Induktion zu allgemeingültigen<br />
Erkenntnis sen gelangen zu können. Popper hält den<br />
In duktionismus auch dann nicht für möglich, wenn<br />
die intendierte strenge Allgemeinheit von induktiv<br />
gewonnenen Erkenntnis sätzen zugunsten ihrer bloß<br />
wahrscheinlichen Gültigkeit auf gegeben wird, wie<br />
Rudolf Carnap dies postuliert. Hypothesen besitzen<br />
nach Popper so lange Gültigkeit, solange sie nicht<br />
falsifiziert sind, wobei selbst Falsifizierungen nur eine<br />
relative Gül tigkeit be sitzen.<br />
Nach Thomas S. Kuhns historisch-deskriptiv orientierter<br />
Wissenschaftstheorie vollzieht sich die Geschichte<br />
der Wissenschaften als eine Folge von Paradigmen,<br />
die durch Sprünge oder Revolutionen zustande kommen.<br />
Unter einem Paradigma versteht Kuhn so etwas<br />
wie ein Schema oder einen Prototyp für Problemlö<br />
sungen, der sich einer exakten Ausformulierung<br />
entzieht. Deshalb kann der Begriff des Paradigmas<br />
nicht mit dem Begriff der Theorie identifi ziert werden.<br />
„Paradigmata erlangen ihren Status, weil sie bei der<br />
Lösung einiger Probleme, welche ein Kreis von Fachleuten<br />
als brennend er kannt hat, erfolgreicher sind<br />
als die mit ihnen konkurrierenden“ (Thomas S. Kuhn:<br />
Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen). Auf der<br />
Ba sis eines allgemein anerkannten Paradigmas betreiben<br />
die Wissenschaftler ihre „Normalwissen schaft“,<br />
die in Anwendun gen („Aufräumarbeiten“) des durch<br />
das Paradigma hergestellten neuen Verständnisses<br />
von Phänomenen liegt. Dieses Paradigma bleibt<br />
gültig, bis innerhalb einer Kri sensitua tion ein neues<br />
entsteht.<br />
Paul Feyerabend verfolgt ähnlich wie Kuhn eine<br />
historische Perspektive. In seinen (antiinduktionistischen)<br />
wissenschaftstheoretischen Über legungen<br />
76<br />
Wissenschafts<strong>philosophie</strong> – Natur<strong>philosophie</strong>