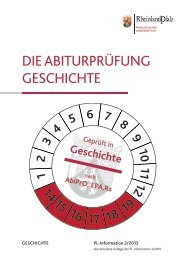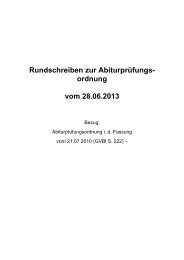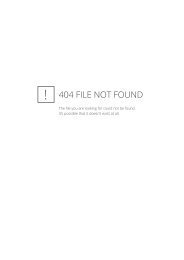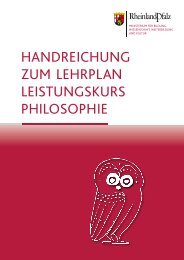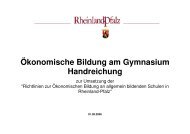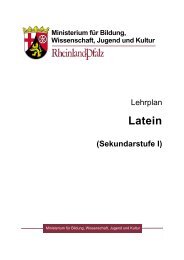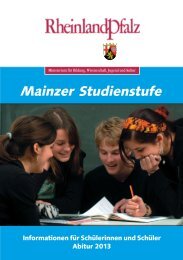handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Handelns mit dem geltenden Recht und Völkerrecht<br />
vor. Nach Jürgen Habermas münden Dis kurse politischer<br />
Willensbildung in juristische Diskurse, um<br />
schließlich in der Gesetz gebung ihren Ausdruck zu<br />
finden. Habermas geht von einer Interdependenz<br />
zwischen Recht und Politik aus, da sich beide wechselseitig<br />
bedingen. Rechts<strong>philosophie</strong> kann als ein<br />
Versuch angesehen werden, eine Wesensbestimmung<br />
des menschlichen Rechts vorzunehmen, die Funktion<br />
und Funktionsweise des Rechts innerhalb der<br />
Gesellschaft zu bestimmen, den Zusammenhang des<br />
Rechts mit dem Staatswesen zu beleuchten sowie<br />
grundlegende Fragen der Legitimation des Rechts<br />
zu beantworten. Das Verhältnis von Recht und Moral<br />
zu bestimmen, gehört zu den bedeutendsten Aufgaben<br />
der Rechts<strong>philosophie</strong>. Die Unterscheidung<br />
von Recht und Moral wird nach gängiger Lehrmeinung<br />
erst als eine Errungenschaft des 18. Jahrhunderts angesehen.<br />
Die kritische Reflexion des Zu sammenhangs<br />
von Machtinteressen und Rechtsordnung, <strong>zum</strong> Beispiel<br />
in totalitären Staaten, gehört weiterhin zu den<br />
wichtigen Problemfeldern der Rechts<strong>philosophie</strong>.<br />
Transdisziplinär ist die Rechts<strong>philosophie</strong> an Ergebnissen<br />
der Rechtsdogmatik (beschäftigt sich systemimmanent<br />
mit geltendem Recht), der Rechtssoziologie<br />
(beschäftigt sich empirisch mit der Wechselwirkung<br />
zwischen Recht und Gesellschaft) und Rechtsgeschichte<br />
(zeichnet die Entwicklung von Rechtsphänomenen<br />
nach) interessiert.<br />
2. Grundzüge der Rechtsordnung des<br />
demokratischen Rechtsstaats<br />
Unter dem Recht versteht man jene Institution, durch<br />
die das „Zusammenleben der Menschen überhaupt<br />
staatlich geregelt ist“. Das Recht kann dies nur leisten,<br />
weil die Rechtsnormen, die in ihrer Gesamtheit das<br />
„hierarchisch gegliederte Rechtssystem“ eines Staats<br />
bilden, im Gegensatz zu morali schen und auf Sitte<br />
sowie Brauchtum beruhenden Normen „Zwangscharakter“<br />
besitzen (Norbert Hoerster: Was ist Recht?).<br />
Durch die nur dem Staat zukommende Ausübung von<br />
Gewalten (Exekutive und Judikative) wird dem Recht<br />
Geltung verschafft. Wie Herbert L. A. Hart herausgearbeitet<br />
hat, können Rechtsnormen in Gebots- bzw.<br />
Verbotsnormen einerseits und Ermächtigungsnormen<br />
ande rerseits unterschieden werden. Die obersten<br />
Normen des Rechtssystems bilden in ihrer Gesamtheit<br />
die Verfas sung eines Staats. Sie regeln die Art<br />
und Weise, wie sich politische Macht konstituiert, sie<br />
definieren aber auch die Grundrechte der Bürgerinnen<br />
und Bürger. Die Ver fassung enthält darüber hinaus<br />
Ermächtigungsnormen, kraft derer Gebots- bzw.<br />
Verbotsnormen durch die dritte Gewalt, die Legislative,<br />
neu geschaffen werden können. Die Verfassung<br />
garantiert zwar dem Staat unter der Maßgabe der<br />
Beachtung der Gewaltenteilung die Ausübung des<br />
Gewaltenmonopols, sie schützt aber auch gleichzeitig<br />
die Bürgerinnen und Bürger kraft der ihnen in der Verfassung<br />
zugesicherten Grundrechte vor der unkontrollierten<br />
Machtausübung des Staats und ge währleistet<br />
so deren „Autonomie“ (Habermas), die wiederum<br />
die Voraussetzung darstellt, dass der demokratische<br />
Meinungsaustausch und somit – um mit Kant zu<br />
reden – „der öffentliche Gebrauch der Vernunft“ (Was<br />
ist Aufklärung?) ungehindert vonstattengehen können.<br />
Gebots- bzw. Verbotsnormen richten sich also<br />
nicht nur an die Bürgerinnen und Bürger eines Staa ts,<br />
sondern auch an den Staat selbst, der durch seine<br />
Amtsträger repräsentiert wird, deren Aufgabe darin<br />
besteht, das Gewaltenmonopol des Staats auszuüben.<br />
3. Naturrecht<br />
Nach dem „Recht des Rechts“ zu fragen, ist nach Max<br />
Weber (Wirtschaft und Gesellschaft) die Grundintention<br />
der Naturrechtslehre. Diese Denktradition, die<br />
auf die An tike zurückgeht, greift in unterschiedlicher<br />
Weise auf den überzeitlichen Maßstab „Natur“ zurück,<br />
der – in Abhängigkeit von den metaphysischen<br />
bzw. naturphilosophischen Voraus setzungen der<br />
verschiedenen Theorien – sowohl äußere wie innere<br />
Natur, Schöpfungsnatur (in der sich der Wille Gottes<br />
ausdrückt), aber auch Natur der Vernunft oder<br />
vernünftige Natur bedeuten kann. Die Gültigkeit<br />
des vom Menschen gesetzten, „positiven“ Rechts<br />
erweist sich im Kontext des naturrechtlichen Denkansatzes<br />
als relativierbar, weil das Naturrecht ein<br />
hö heres Recht repräsentiert als das positive Recht.<br />
Dass somit ein Spannungsverhältnis <strong>zum</strong> positiven<br />
Politische Philosophie – Rechts<strong>philosophie</strong> 107