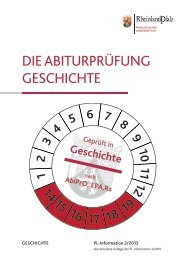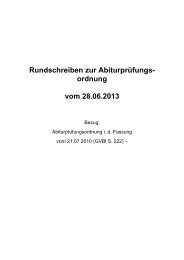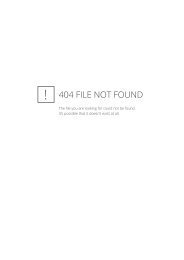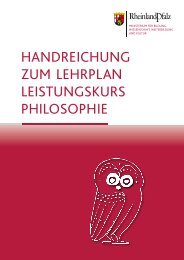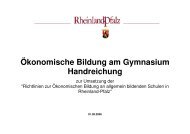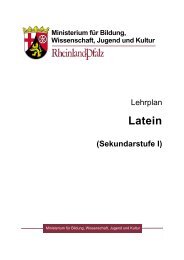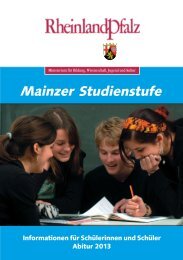handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Arbeiten an künstlichen und neuronalen Netzwerken<br />
zu einem Ver ständnis unserer Hirnfunktionen gelangt<br />
zu sein und auf dessen Basis weit reichende Aus sagen<br />
über mentale Phänomene, den menschlichen Geist,<br />
machen zu können; er spricht vom „transparenten<br />
Gehirn“ (Paul M. Churchland: Die Seelenmaschine,<br />
Kap. 8-9). Churchland kann dem „eliminativen<br />
Materialismus“ zugerechnet werden. „Eliminativ“ in<br />
die sem Sinne bedeutet, dass der Anspruch erhoben<br />
wird, „mentalistische Alltagsbegriffe“ durch präzisere<br />
neurobiologische Termini zu ersetzen, um das noch<br />
weit verbreitete dualistische Denkmuster endgültig<br />
aufzulösen. Lebewesen werden verstanden als komplexe<br />
physika lisch-chemische Prozesse, und darin<br />
liegt nach Churchland ein überaus wichtiges medizinisch-diagnostisches<br />
Potenzial. Die Forschung könnte,<br />
so Churchland, bald in der Lage sein, neurologische<br />
Erkrankungen besser zu diagnostizieren und zu heilen.<br />
Churchland betont die sozialen und ethischen<br />
Konsequenzen, die aus diesen neuen Er kenntnissen<br />
resultieren. Es geht ihm um die Entmystifizierung<br />
von Begriffen wie „Seele“, „Ich“ etc. „Die Doktrin einer<br />
immateriellen Seele scheint mir, wie jeder Mythos,<br />
nicht nur oberflächlich, sondern auch falsch“ (Churchland:<br />
Die Seelenmaschine Kap. 8). Der Leib-Seele-<br />
Dualismus präge leider auch heute noch das soziale<br />
und moralische Bewusstsein vieler Menschen aus den<br />
unterschiedlichsten Kulturen. Es wäre im Hinblick auf<br />
unsere Zu kunft notwendig, auf der Basis der neuen<br />
Erkenntnisse, dem neuen Wissen um das „Wesen des<br />
Menschen“, den Sinn des Lebens neu zu definieren<br />
und ein neues ethisches Funda ment zu entwickeln.<br />
Der Philosoph Thomas Metzinger, der die These vom<br />
„phänomenalen Selbst“ vertritt, sieht ebenfalls eine<br />
dringende Notwendigkeit, dass unsere Gesellschaft<br />
auf die technologische Umsetzung von neuem Wissen<br />
reagiert. Er stellt sich einen neuen Zweig der angewandten<br />
Ethik vor, eine „Bewusstseinsethik“, die sich<br />
damit auseinandersetzt, wie wir mit unseren Bewusstseinszuständen<br />
künftig gesellschaftlich umgehen<br />
wollen. Dies sei schon deshalb vonnöten, da zukünftig<br />
die alten traditionellen ethischen Denkmuster in<br />
zunehmend größer werdenden „Handlungsspielräumen“<br />
nicht mehr ausreichen bzw. versagen werden.<br />
Die Frage aus der klassischen Ethik „Was ist eine gute<br />
Handlung?“ wäre in der neuen Be wusstseinsethik<br />
nach Metzingers Vorstellung zu ersetzen durch die<br />
Fragestellung „Was ist ein guter Bewusstseinszustand?“<br />
So schreibt Metzinger: „Bei der Bewusstseinsethik<br />
ginge es also um eine normative Be wertung nicht<br />
von Handlungsformen, sondern von Erlebnisformen“<br />
(Metzinger in: Gehirn & Geist 6/2006). Die Bewusstseinsethik<br />
könnte man demnach als jenen Teil<br />
der an gewandten Neuroethik definieren, der sich<br />
mit Handlungen auseinandersetzt, deren primä res<br />
Ziel es sei, den „phänomenalen Inhalt“ der geistigen<br />
Zustände empfindungsfähiger We sen in eine bestimmte<br />
Richtung zu verändern. Metzinger stellt<br />
hier einen Bezug <strong>zum</strong> aufklärerischen Ansatz Kants<br />
her, insofern, dass wir auf der Basis unseres neuen<br />
Wissens über Denkvorgänge neue Ansätze <strong>zum</strong> Ideal<br />
der Selbsterkenntnis entwickeln könnten, was uns<br />
dem Ziel der Aufklärung „Ausgang des Men schen<br />
aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit“ näher<br />
bringe (Metzinger in Gehirn&Geist 6/2006). Er stellt<br />
die Frage, wie es denn möglich sei, dass „Bewusstsein“,<br />
„bewusstes Erleben“ in einem physikalischen<br />
Universum entstehen konnte. Das Rätsel des „Bewusstseins“,<br />
so Metzinger, impliziert zwingend auch<br />
die Frage nach dem „eigenen Bewusstsein“: „Das<br />
Problem ist damit auch ein Problem der Selbsterkenntnis“<br />
(Metzinger: Philosophie des Geistes 1, Einführung).<br />
Metzinger entwirft die „Selbstmodell-<br />
Theorie der Sub jektivität“. Er geht der Frage nach<br />
dem „Ich“ bzw. dem „Selbst“ nach. Das „Ich“ ist<br />
das Zentrum einer virtuellen Welt, die vom Gehirn<br />
erzeugt wird – also eine „Illu sion“. Die provokante<br />
Aussage „Niemand wird je geboren. Niemand stirbt<br />
je“ bringt diesen Ansatz deutlich <strong>zum</strong> Ausdruck.<br />
Das „phänomenale Selbst“ dient Metzinger als eine<br />
„theoretische Entität“, das „Selbst“ verweist auf<br />
kein Individuum im metaphysischen Sinne, ist keine<br />
„unwandelbare, ontologische Substanz“, sondern<br />
ein „dynamischer Vorgang“ eines „informationsverarbeitenden<br />
Systems“. Es ist lediglich der „Inhalt<br />
eines Selbstmodells“, das von dem System, „das<br />
es benutzt, nicht als Modell erkannt werden kann“,<br />
es ist „der Inhalt des bewussten Selbst“ (Metzinger:<br />
Being no one, Niemand sein. Das Selbst als Muster<br />
und Mythos, in: Philosophie des Geistes 2). Hier<br />
stellt sich insbesondere auch die Frage nach der<br />
Willensfreiheit des Menschen, also danach, ob und<br />
inwiefern wir von unserem Gehirn determiniert sind<br />
Erkenntnistheorie – Philosophie des Geistes 97