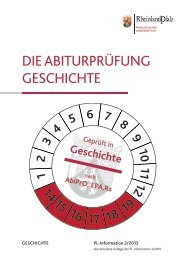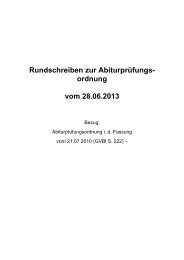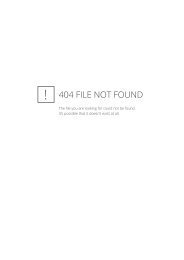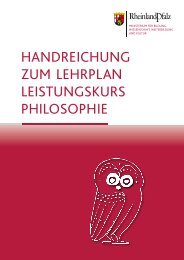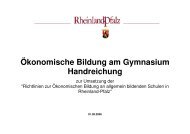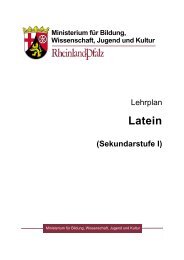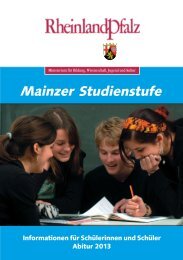handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Ethik<br />
der philosophischen ethik, von aristoteles unter dem<br />
titel ta ethika als disziplin in die Phi losophie eingeführt,<br />
geht es darum, Grundsätze des guten Handelns und<br />
des guten lebens zu finden und darzulegen, dass nach<br />
deren Maßgabe der Mensch sein ganzes praktisches<br />
leben (seine Maximen, seine grundlegenden einstellungen<br />
gegenüber sich selbst, seinen Mitmenschen<br />
und der natur, seine Pflichten und rechte, sowie<br />
sein Glücksstreben, sein Streben nach Selbstverwirklichung<br />
und sein konkretes Handeln) reflektieren,<br />
kritisch be werten und letztlich auch autonom bestimmen<br />
kann. Wie genau aus der bloß reflexiven ein sicht<br />
auch ein gutes Handeln entspringen kann, gehört zu<br />
den offenen Fragen ethischer re flexion, auch der<br />
gegenwärtigen. Bereits der etymologische ursprung<br />
des Wortes (von grie chisch „ethos“: Sitte, Gewohnheit)<br />
verweist darauf, dass ethik ihren ausgang nimmt<br />
von ge sellschaftlich anerkannten einstellungen und<br />
normen, die den Kontext darstellen, auf den sich<br />
die philosophische ethik bezieht. anthropologisch<br />
gesehen tragen Moral und ethik dem umstand rechnung,<br />
dass der Mensch der aus der natur entlassene<br />
ist, der als soziales We sen richtlinien für sein Handeln<br />
braucht, um als „Mängelwesen“ nicht überfordert<br />
zu sein. ethik kann somit die soziale integration des<br />
individuums intendieren. ethik kann sich aber auch<br />
der Frage nach dem Wert des ungehorsams und der<br />
nonkonformität zuwen den. die Fähigkeit zu rationaler<br />
Kritik sowie die Fähigkeit, rationale Kritik dialogisch<br />
zu ver mitteln, sollten <strong>zum</strong> Wertekonsens jeder ethik<br />
gehören. insofern sie philosophisch begrün dete Orientierungsmaßstäbe<br />
für das richtige bzw. gute Handeln<br />
bereitstellt, ist ethik normativ, als sol che abzugrenzen<br />
von der empirisch orientierten ethik (Soziologie,<br />
Psychologie), deren inten tion darin besteht, moralische<br />
Wert systeme deskriptiv zu erfassen, aber auch<br />
von der Meta ethik, die das ethische argumentieren<br />
und die Sprache der ethik <strong>zum</strong> Gegenstand hat und<br />
deren intention darin zu sehen ist, ethik auf ihre Möglichkeit<br />
hin zu überprüfen (George edward Moore,<br />
richard Mervin Hare u. a.). an welchen Wertmaßstäben<br />
und normen Menschen tatsächlich ihr leben<br />
und Handeln ausrichten, wird somit von der deskriptiven<br />
ethik erfasst; Fragen wie <strong>zum</strong> Beispiel die, was wir<br />
überhaupt meinen, wenn wir im Kontext moralischer<br />
urteile den Begriff des „Guten“ verwenden, gehören<br />
zur Metaethik. Metaethische reflexionen können<br />
selbstverständlich auch im Kontext normativer argumentationen<br />
auf tauchen.<br />
im Zentrum der philosophischen ethik steht somit<br />
die normative ethik. die gängige definition, ethik sei<br />
reflexion der Moral, fokussiert ein modernes Verständnis<br />
von ethik, für das das Gute primär ein moralisch<br />
Gutes darstellt. Beispielhaft für dieses neuzeitliche<br />
Verständnis von ethik kann auf die ersten Sätze der<br />
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten verwiesen<br />
werden, in denen immanuel Kant die berühmte these<br />
entwickelt, allein ein „guter Wille“ sei auch „schlechthin“<br />
gut zu nennen: „Es ist überall nichts in der Welt,<br />
ja überhaupt auch außer derselben zu denken möglich,<br />
was ohne Einschränkung für gut könnte gehalten<br />
werden, als ein guter Wille“ (immanuel Kant: Grundlegung<br />
zur Metaphysik der Sitten). das Gut-Sein dieses<br />
Willens setzt Kant mit moralischem Gut-Sein gleich.<br />
Moralisch gut ist dieser Wille, weil er sich als reiner<br />
Wille selbst ein Gesetz gibt und sich somit selbst<br />
bestimmt. alle triebfedern der Sinnlichkeit, wie <strong>zum</strong><br />
Beispiel egoistische neigungen, sind von dieser idee<br />
einer reinen prak tischen Vernunft fernzuhalten. Kritiker<br />
der ethik Kants, wie <strong>zum</strong> Beispiel Max Scheler,<br />
be mängeln den Formalismus dieser ethischen theorie.<br />
Otfried Höffe beispielsweise verteidigt sie gegen<br />
den Vorwurf des Formalismus, indem er diese als<br />
„Maximenethik“ inter pretiert; er sieht in dem Formalismus-Vorwurf<br />
ein Missverständnis (Otfried Höffe:<br />
Ethik des kategorischen Imperativs; in: annemarie<br />
Pieper (Hg.): Geschichte der neueren Ethik 1). andere<br />
beurteilen den ansatz einer ethik der reinen praktischen<br />
Vernunft überhaupt als ungeeignet, ein<br />
erfolgrei ches Handeln zu begründen. Wie aus einem<br />
freien, autonomen Willen auch ein Können, ein erfolgreiches<br />
Wollen folge, erkläre diese nur ansatzweise.<br />
Peter Baumanns (Einführung in die praktische Philosophie)<br />
vertritt die auffassung, dass bereits thomas<br />
Hobbes mit den Voraussetzungen seiner Philosophie<br />
so etwas wie autonomie denken könne; sein Kontraktualismus<br />
beruhe auf der theorie der Gleichursprünglichkeit<br />
von Forderungen der triebnatur (vernunftloses<br />
Selbsterhaltungsstreben um jeden Preis) und<br />
moralischer, aber noch ohnmächtiger Forderung der<br />
Vernunft, Frieden zu stiften (das „Gesetz der Natur“<br />
formal gedeutet als hypothetischer imperativ).<br />
82<br />
Ethik