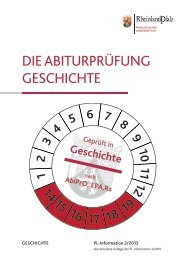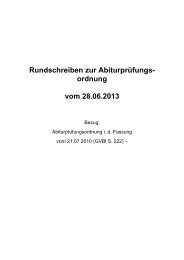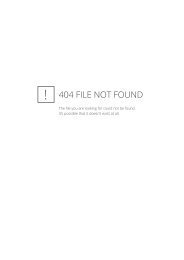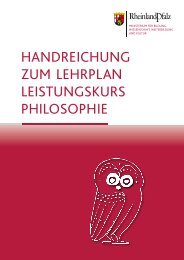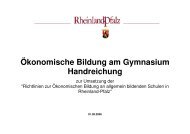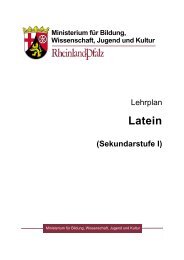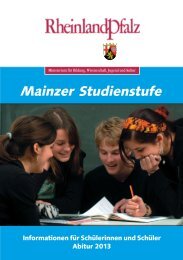handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Gründe für die Existenz eines Staates gibt und danach,<br />
wie dieser Staat beschaffen sein soll. Im Wesentlichen<br />
widmet sich die Reflexion der Fragestellung, wie<br />
menschliches Miteinander in Institutionen gemäß<br />
be stimmten Prinzipien gestaltet sein soll. Dabei<br />
handelt es sich nicht ausschließlich um einen Diskurs<br />
darüber, warum und worin Staatsgewalt besteht,<br />
sondern es geht auch um die Frage nach der Berechtigung<br />
eines Staates, also auch um die Frage nach<br />
dessen ethischer Begründung. Somit beinhaltet der<br />
normative Begriff der Legitimation einen zentralen<br />
Bezug zur Praktischen Philosophie.<br />
c. Deskriptive Elemente im Kontext normativer<br />
Begründungszusammenhänge (theologisch,<br />
metaphysisch, empirisch)<br />
Kernfragen lauten hier: Sind wir Menschen auf den<br />
Zusammenschluss in politischen Gemeinschaften<br />
angelegt? Gibt es eine dem irdischen Leben übergeordnete<br />
Seins ordnung, die sich auf Gesetze zurückführen<br />
lässt, wie beispielsweise kosmische Ge setze,<br />
Schöpfungsplan, gesetzmäßige Verlaufsstrukturen<br />
von Weltgeschichte? Verfügt der Mensch über natürliche<br />
Anlagen, die ihn zu einem Leben in politischen<br />
Gemein schaften befähigen? Deskriptive Fragen<br />
ergeben sich dadurch, dass staatstheoretische Reflexionen<br />
stets auch neue Erkenntnisse der empirischen<br />
Wissenschaften über den Menschen (z. B. Psychologie,<br />
Sozialwissenschaften) mit einbeziehen müssen.<br />
Staatsphilosophische Positionen können nach<br />
Hoerster aus drei möglichen Blickwinkeln betrachtet<br />
werden: ideengeschichtlich als fortschreitende<br />
Entwicklung im Kontext vorher gehender und nachfolgender<br />
Theorien, historisch im Kontext der <strong>zum</strong><br />
jeweiligen Zeitpunkt herrschenden politischen Praxis<br />
(Macht- und Herrschaftsstrukturen bzw. wirtschaftliche<br />
Strukturen) und als theoretische Auseinandersetzung<br />
mit der jeweiligen Position im Hinblick auf<br />
ihre Tauglichkeit für die Entwicklung einer aktuellen,<br />
auf die Gegenwart bezogenen The orie (Norbert<br />
Hoerster: Klassische Texte der Staats<strong>philosophie</strong>,<br />
Einleitung).<br />
Wie Norbert Hoerster sieht auch Christoph Horn<br />
drei Reflexionsebenen der Politischen Philosophie:<br />
Begriffsanalyse, normative und deskriptive Ebene. In<br />
seiner Schrift Einführung in die Politische Philosophie<br />
sieht Horn den Terminus Staats<strong>philosophie</strong> als veralteten<br />
Be griff für den Bereich der Politischen Philosophie,<br />
den er als einen Teil der Praktischen Philo sophie<br />
ansieht und der Querverbindungen enthält zu Moral<strong>philosophie</strong>,<br />
Sozial<strong>philosophie</strong> und Rechts<strong>philosophie</strong>.<br />
Ausgangspunkt der Politischen Philosophie wie auch<br />
der klassi schen Staats<strong>philosophie</strong> ist der Staatsbegriff.<br />
Ganz allgemein befasst sich die Politische Philosophie<br />
mit der politischen Ordnung von staatlichen Systemen,<br />
untersucht also mit Hilfe politischer Modelle<br />
des Staates das Zusammenspiel von ökonomischen,<br />
rechtlichen und po litischen Systemen. Dabei rücken<br />
Entstehung, Legitimation, Aufgaben, Ziele und die<br />
diesen Zielen angemessene institutionelle Form des<br />
Staates in den Mittelpunkt. Der Begriff „Staat“ wird<br />
dabei nicht zu eng gefasst, vielmehr wird die Reflexion<br />
auf alle Formen politischer Or ganisation (lokal,<br />
regional, international) ausgerichtet. Im gegenwärtigen<br />
philosophischen Diskurs zeichnet sich eine<br />
Tendenz ab, staatsphilosophische Reflexionen in die<br />
Disziplin der Politischen Philosophie einzuschließen.<br />
Die Politische Philosophie und somit auch die Staats<strong>philosophie</strong><br />
können auf anthropologi sche Theorien<br />
nicht verzichten, denn alle Staatstheorien basieren<br />
auf Menschenbildern, die den jeweiligen staatstheoretischen<br />
Ansatz entscheidend prägen; die jeweiligen<br />
anthropologi schen Grundannahmen können sich sehr<br />
stark voneinander unterscheiden. Thomas Hobbes’ anthropologische<br />
Voraussetzung zeigt einen Menschen,<br />
der von Natur aus stets nach sei nem Überlebenswillen<br />
handelt. Hobbes’ berühmte Sentenz „homo<br />
homini lupus“ zeichnet ein Bild des Menschen, das<br />
sich eklatant von der aristotelischen Vorstellung des<br />
Menschen als „zoon politikon“ unterscheidet. Jean-<br />
Jacques Rousseau hält den Menschen von Natur aus<br />
für gut; erst durch die Sozialisation in gesellschaftliche<br />
Einrichtungen entfremdet er sich von seinem<br />
natürlichen Gut-Sein und wird verdorben. Immanuel<br />
Kant geht von einem von der Natur eingerichteten<br />
menschlichen „Antagonismus“ aus (das Bedürfnis sich<br />
zu ver einzeln, sich aber auch zu vergesellschaften),<br />
spricht im Hinblick auf eine Staatserrichtung von<br />
einem „Volk von Teufeln“, das eines Herrn bedarf (vgl.<br />
dazu den Arbeitsbereich „Ge schichts<strong>philosophie</strong>“).<br />
Niccolò Machiavelli vertritt die Auffassung, dass der<br />
Mensch, der nur das Gute erstrebt, zugrunde gehen<br />
muss, weil er inmitten von Menschen lebt, die nicht<br />
gut sind; daher muss ein Herrscher lernen, sich wie<br />
ein Fuchs zu verhalten, das heißt wie ein Meister, der<br />
Politische Philosophie – Rechts<strong>philosophie</strong> 101