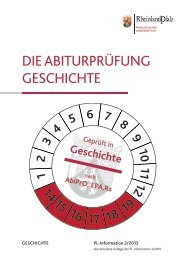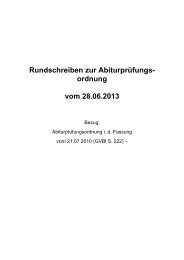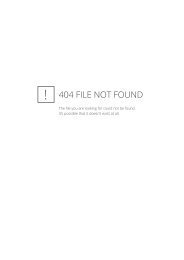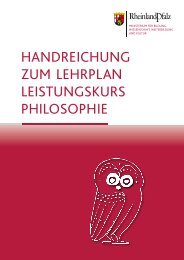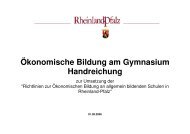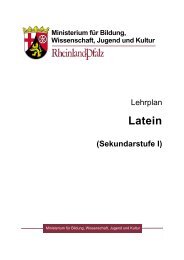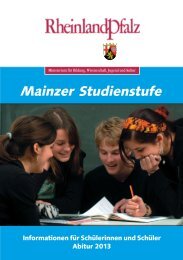handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
die Kunst von Heuchelei und Verstellung beherrscht.<br />
Ganz allgemein kann man aus der Sicht der Politischen<br />
Anthropologie von zwei entgegengesetzten<br />
Grundproblemen aus gehen: Zu klären ist, ob der<br />
Mensch grundsätzlich über ein Bedürfnis nach Bildung<br />
einer harmonischen Gemeinschaft verfügt, oder ob<br />
er vielmehr zu Konflikten neigt und der Gemeinschaft<br />
bedarf, um kriegerische bzw. destruktive Konfliktstrukturen<br />
<strong>zum</strong> Wohle aller zu vermeiden.<br />
2. Klassische Modelle der Staatsbegründung<br />
a. Staat und „eudaimonia“<br />
Anfänge staats- und rechtsphilosophischer Theorien<br />
finden wir im europäischen Kulturkreis bereits im<br />
antiken Griechenland. Staatsphilosophische Ansätze<br />
der Antike stellen grundsätz lich die Frage nach dem<br />
Ursprung der Stadtbildung, dem guten und gerechten<br />
Leben in Gemeinschaften, wie dieses aufgebaut<br />
und erhalten werden kann. Der innere Zusammenhang<br />
von Politik, Ethik, Bildung, Gesetz und Religion<br />
steht im Vordergrund der Reflexion <strong>zum</strong> gerechten<br />
Staat, der für eine gelungene Lebensführung oder<br />
der „eudaimonia“ un abdingbar ist. Insbesondere in<br />
den Werken Politeia, Politikos und Nomoi legt Platon<br />
ein differenziertes Konzept von Staatenbildung vor.<br />
Menschliches und Göttliches stehen bei den Griechen<br />
hinsichtlich des politischen Denkens stets in Beziehung<br />
oder auch in Spannung zueinander. Die Errichtung<br />
des besten Stadtstaates gründet nach Platon<br />
auf der Weisheit der Philosophen, die durch diese<br />
Weisheit den Aufstieg zur Idee des Guten auf sich<br />
nehmen (Platon: Politeia 428-429, vgl. auch Höhlengleichnis<br />
in Politeia 514-519). Die Orientierung an den<br />
Göttern im platonischen Sinne ist philosophisch, sie<br />
bedarf der Argumentation. Die Existenz der Götter<br />
wird über kosmische Bewegung und Selbstbewegung<br />
dargelegt, Be wegung verstanden als ältestes Prinzip<br />
der Seele. In seinem Werk Politeia schlägt Platon eine<br />
expertokratisch orientierte Politik vor, in der Philosophen<br />
als Regierende, als der Weis heit Zugeneigte,<br />
den Staat leiten. Sie sollen nicht nur in der Theorie,<br />
sondern auch in der Praxis (u. a. Gymnastik, Musik,<br />
Dialektik) ausgebildet werden. In seinem Werk Nomoi<br />
zeigt uns Platon eine Gesetzesstadt, in der Gesetze<br />
<strong>zum</strong> Erhalt und Bestand des inneren Frie dens beitragen<br />
sollen. Dennoch bleibt nach Platon die Herrschaft<br />
der Gesetze ein Not behelf; die Herrschaft von<br />
vernünftigen Personen ist vorzuziehen, da Gesetze<br />
unflexibel sind, gleich eines „starrköpfigen und ungebildeten<br />
Mannes“ (Platon: Nomoi 294). Die Ge setze<br />
Platons, die Androhung von Strafen und Sanktionen<br />
vorsehen, beinhalten <strong>zum</strong> Teil sehr scharfe Gesetze<br />
(Asebiegesetze) gegen Atheisten, Magier und Gotteslästerer,<br />
was den modernen Leser in ein gänzlich<br />
antikes Denken versetzt, wie z. B. die Vorstellung des<br />
„Sophronisterion“ (Besinnungshaus für noch Uneinsichtige,<br />
Nomoi 909) oder dass die Leich name der<br />
durch Todesstrafe getöteten uneinsichtigen Feinde<br />
der Götter ohne Beerdigung einfach über die Landesgrenzen<br />
geworfen werden sollen. So werden wir auch<br />
in der Politeia (389 u. 459) mit der „edlen Lüge“<br />
konfrontiert, die den Herrschenden Lügen gegenüber<br />
den (ungebildeten) Beherrschten einräumt<br />
<strong>zum</strong> Zwecke des Wohlergehens aller.<br />
Aristoteles begreift den Menschen als „zoon politikon“,<br />
das heißt als ein Wesen, das – um die in ihm angelegte<br />
Entelechie zur Entfaltung und Verwirklichung<br />
bringen zu können – der Gemeinschaft bedarf. Der<br />
Mensch ist „von Natur aus politisch“; einerseits hat<br />
er ein Bedürf nis nach Selbsterhaltung, andererseits<br />
strebt er nach dem „guten Leben“. Wie Platon geht<br />
auch Aristoteles davon aus, dass eine gelungene<br />
Lebensführung, ein tugendhaftes Leben, das zur<br />
„eudaimonia“ führt, nur in einer politischen Gemeinschaft<br />
möglich ist (Aristoteles: Politik 1324).<br />
Das ethisch-anthropologisch fundierte Staats- und<br />
Rechtsdenken der Griechen bildet die Grundlage für<br />
die weitere Entwicklung im Römischen Reich, im<br />
Mittelalter und in der Neuzeit. Römische staatsrechtliche<br />
Konzepte entwickelten ein differenziertes Bürgerrecht,<br />
eine durch die Bedeutung des römischen Reiches<br />
als Weltmacht notwendige Außenpolitik, stets<br />
ver bunden mit einer deutlichen Orientierung an den<br />
Göttern (Zeichendeutungen, Befragen von Götterwillen)<br />
und mit der Bewahrung der Traditionen. Priester<br />
waren stets in politische Ent scheidungsfindungen<br />
eingebunden. Auch die Entwicklung des Humanismus<br />
in der römi schen Kultur („humanitas“) geht auf das<br />
griechische Erbe zurück, insbesondere auf die Vorstellungen<br />
von „philanthropia“ (Menschenfreundlichkeit)<br />
und „paideia“ (Menschenbildung).<br />
102<br />
Politische Philosophie – Rechts<strong>philosophie</strong>