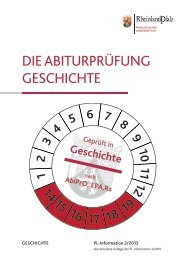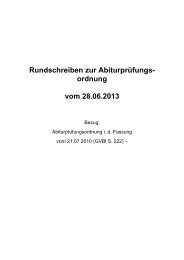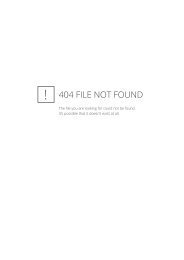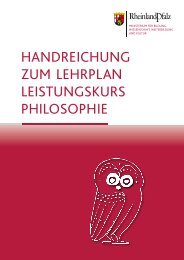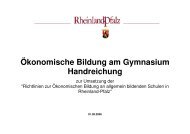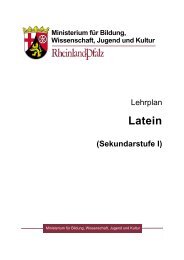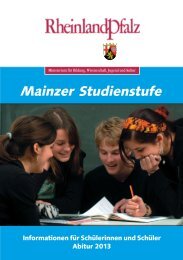handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Sprachanalytische Reflexionen, wie von Quine, diejenigen<br />
des Behaviorismus, der Wiener Schule oder von<br />
Wittgenstein stellen Grundlagen der Philosophie des<br />
Geistes in Frage. Bedeutet dies das Ende der Philosophie<br />
des Geistes? Bieri ist der Auffassung, dass die<br />
sprachanalytische Reflexion für die Philosophie des<br />
Geis tes eine „diagnostische und kritische Phase“ war,<br />
die die Philosophie des Geistes enorm be reicherte,<br />
doch auch diese Ansätze haben nach Bieri ihre Schwächen<br />
und Lücken, wie etwa Quines „semantic ascent“.<br />
Im Hintergrund dieser Strategie liegt eine inhaltliche<br />
Prämisse, wie Bieri sagt, die „erkenntnistheoretische<br />
Prämisse“, dass wir „keinen epistemischen Zu gang zu<br />
den Phänomenen haben, der unabhängig von Sätzen<br />
ist“ (Bieri, in: Analytische Philosophie des Geistes,<br />
1. Teil). Die Verknüpfung von Erkenntnistheorie und<br />
Philosophie des Geistes wird insbesondere erkennbar<br />
an Einflüssen aus dem logischen Empirismus (Wiener<br />
Schule), der sich darum bemühte, sinnvolle, verifizierbare<br />
Sätze, also „echtes Wis sen“, von metaphysischen<br />
Spekulationen zu unterscheiden (vgl. Arbeitsbereich<br />
Sprach <strong>philosophie</strong>).<br />
Fragen wie z. B. „Ist die Außenwelt wirklich?“ sind<br />
nach Carnap „Scheinfragen“, sie sind nach Carnap<br />
mit Bezug auf Wittgensteins „Verifikationsprinzip“<br />
„nicht kognitiv“. Es handelt sich um die These, dass<br />
die Bedeutung eines Begriffsinhaltes durch die Verifikations<br />
bedingungen des Satzes festgelegt wird (vgl.<br />
Rudolf Carnap: Mein Weg in die Philosophie, II, 5).<br />
Einen weiteren Einfluss stellt der „wissenschaftliche<br />
Realismus“ dar, der mit dem An spruch auftritt, ontologische<br />
Fragestellungen nach den Gesichtspunkten<br />
empirischer Theo rien zu beantworten. Nach Ernst<br />
von Glasersfeld, Vertreter des „radikalen Konstruktivismus“,<br />
ist die Macht von „eingebürgerten Begriffen“<br />
kaum zu überschätzen. In seiner Schrift Konstruktion<br />
der Wirk lichkeit und des Begriffs der Objektivität legt er<br />
dar, dass Begriffe unser Welt- und Selbstbild prägen.<br />
Es ist über einen langen Zeitraum die Vorstellung<br />
gewachsen, dass Wissen über das, was wir erkennen<br />
oder erleben, nur dann Wissen ist, wenn es mit einer<br />
vom Erkennen den unabhängigen Welt „wahrheitsgetreu“<br />
übereinstimmt (Isomorphie). In diesem „herkömmlichen<br />
Begriffsschema“ setzt Erkennen von etwas<br />
die Vorstellung voraus, dass der Mensch in seiner<br />
Wahrnehmung „von außen“ angeregt wird, etwas zu<br />
erkennen, was sich außerhalb von ihm befindet und<br />
erkannt werden kann. Dieses „Missverständnis“ – so<br />
Glasersfeld – war schon zur Zeit des Sokrates „tief<br />
verwurzelt“ und „eingefleischt“. Er verweist auf<br />
Platons Dialog Theaithetos, wo diese Vorstellung<br />
sehr deutlich <strong>zum</strong> Ausdruck kommt: „Wenn ich […]<br />
wahrnehmend werde, muss ich es notwendig in Beziehung<br />
auf etwas werden; denn ein Wahrnehmender<br />
zu werden ohne etwas wahrzunehmen, ist unmöglich.<br />
Der Gegenstand aber muss, wenn er süß oder bitter<br />
oder dergleichen wird, es für jemanden werden; denn<br />
süß zu werden, aber für niemanden süß, ist unmöglich“<br />
(Platon: Theaitetos 160 ).<br />
Vertreter der Skepsis haben, so Glasersfeld, daran<br />
nichts geändert: Bis <strong>zum</strong> 17. Jahr hundert stand<br />
hinsichtlich der Sinneswahrnehmung der „Zweifel“<br />
im Brennpunkt der philoso phischen Reflexion<br />
(Descartes), im 18. Jahrhundert führte Hume die<br />
Verbindung von Ur sache und Wirkung, also kausale<br />
Erklärungen, auf Assoziationen des Erkennenden<br />
zurück, und schließlich schloss Kant die Möglichkeit<br />
der wahren Erkenntnis aus, indem er Raum und Zeit<br />
als Anschauungsformen a priori im Bereich des subjektiv<br />
Phänomenalen annahm. „Das Ding an sich ist<br />
nicht erkennbar“ – diese These Kants macht deutlich,<br />
dass eine wahr heitsgetreue Vorstellung bzw. Darstellung<br />
einer ontischen Wirklichkeit („noumena“)<br />
nicht vor ausgesetzt werden kann. Doch trotz dieser<br />
philosophisch-erkenntnistheoretischen Reflexion<br />
hat sich nach Glasersfeld das traditionelle Weltbild<br />
vom objektiven Wissen einer absoluten Wahrheit als<br />
äußerst hartnäckig erwiesen. Der radikale Konstruktivismus<br />
ersetzt nun die traditionelle Vorstellung von<br />
einer Beziehung zwischen ontischer Welt und Erkennendem<br />
durch ein „anderes begriffliches Verhältnis“.<br />
Die traditionell angenommene Isomorphie, die „Übereinstimmung“<br />
oder „Gleichförmigkeit“, wird im Sinne<br />
Glasersfelds vollkommen anders gedacht, nämlich<br />
als „Viabilität“: „Handlungen, Begriffe und begriffliche<br />
Operationen sind dann viabel, wenn sie zu den Zwecken<br />
oder Beschreibungen passen, für die wir sie nutzen. […]<br />
Wissen ist kein Bild oder keine Repräsentation der<br />
Realität, es ist vielmehr eine Landkarte dessen, was<br />
die Realität uns zu tun erlaubt. Es ist das Repertoire an<br />
Begriffen, begrifflichen Beziehungen und Handlungen<br />
oder Operationen, die sich in der Verfolgung un serer<br />
Ziele als viabel erweisen“ (Ernst von Glasersfeld:<br />
Konstruktion der Wirklichkeit und des Begriffs der<br />
Erkenntnistheorie – Philosophie des Geistes 91