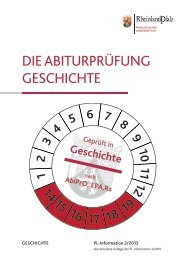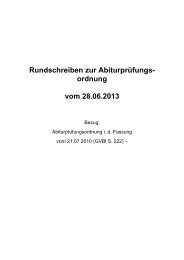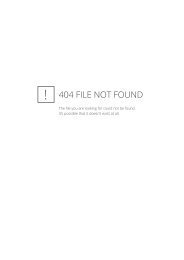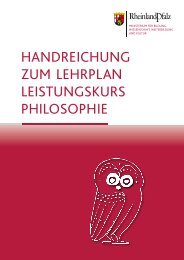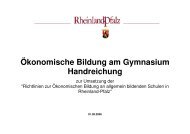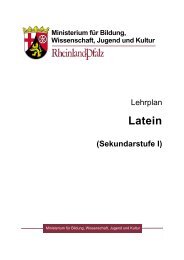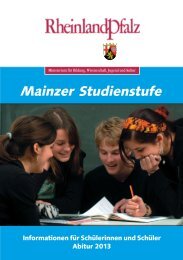handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
3. Sprachreflexionen im Mittelalter<br />
Sprachphilosophische Reflexionen des Mittelalters<br />
sind über weite Teile geprägt vom „Uni versalienstreit“.<br />
Dabei geht es um das Kernproblem, wie übergeordnete<br />
Allgemein begriffe, Gat tungsbegriffe wie z. B.<br />
geometrische Figuren oder die Gattung „Pferd“,<br />
„Säuge tier“ etc., also so genannte „Universalien“,<br />
entstehen bzw. entstanden sind. Hierzu gibt es<br />
grundsätz lich zwei einander wi dersprechende Hauptpositionen:<br />
Nach Auffassung der Nominalisten sind<br />
nur die Individuen real, da nur diese empirisch wahrnehmbar<br />
sind. Begriffe – die „Universalien“ – hingegen<br />
sind nachgeordnet, d. h. vom Menschen entwickelt.<br />
Ohne die Tä tigkeit des menschlichen Geistes bzw. der<br />
menschlichen Seele gäbe es nach dieser Auffas sung<br />
keine „Universalien“. Gegenposi tionen vertreten die<br />
Auffassung, dass die Begriffe in der Natur vorhanden<br />
sind, d. h. dass sie auch ohne den Menschen existieren.<br />
Ihr Ursprung wird, da die Philosophie im Mittelalter<br />
eng mit der Theologie verflochten ist, <strong>zum</strong>eist in<br />
Gott bzw. einem göttlichen Schöpfungsakt gesehen.<br />
Hauptvertreter sind u. a. Augustinus und Boethius.<br />
Ihrer Auffassung nach existieren die Be griffe bzw.<br />
„Universalien“ vor den Dingen, d. h. der Ursprung aller<br />
Dinge liegt in den letztlich von Gott geschaffenen<br />
„Universalien“. Insge samt ist bei Betrachtung und<br />
Reflexion der mittelalterli chen Philosophie zu bedenken,<br />
dass es dabei immer auch um eine theologische<br />
Positionierung geht; so darf eine erkenntnistheoretische<br />
oder sprachphilosophische Position nicht<br />
im Wider spruch zur christlichen Schöpfungslehre<br />
oder <strong>zum</strong> christlichen Glauben an einen dreieinigen<br />
Gott stehen. Sprach theorie diente prioritär der<br />
theologischen Spekulation im Hinblick auf eine<br />
Rechtfertigung und Beweisführung der Existenz<br />
Gottes. Es herrschte die Vorstellung vor, dass Äußerungen<br />
Gottes in Zeichen der Sprache inhärent sind.<br />
Eine nominalistische Position bei spielsweise, die<br />
„Universalien“ und Gattungsbegriffe als nach den<br />
Dingen Entstandenes annimmt, wird in diesem Sinne<br />
schnell angreifbar, da hier eine Leugnung der Glaubensauffassung<br />
ver mutet wurde, dass alles Existierende<br />
Schöpfung Gottes sei – was somit auch die<br />
„Universalien“ ein schließt.<br />
4. Sprachreflexion in der Neuzeit:<br />
Nach Thomas Hobbes entsprechen die Worte nicht<br />
dem Wesen der (wirklichen) Dinge, son dern beziehen<br />
sich auf Vorstellungen von den Dingen. Somit birgt<br />
Sprache die Gefahr der Verschleie rung von Unwissen,<br />
auch Täuschung durch strategisch eingesetztes Lügen.<br />
Dies impliziert auch die Selbsttäuschung, was gerade<br />
im Hinblick auf Politik besonders den Men schen <strong>zum</strong><br />
Nachteil gereicht, nämlich dann, wenn durch Wortkunst<br />
Gutes als Böses oder Böses als Gutes um gedeutet<br />
werden kann, was den Frieden unter den<br />
Menschen erheblich zu stören vermag. So beleuchtet<br />
Hobbes Vor- und Nachteile der Sprache und hebt<br />
den As pekt der Sprache als Mittel der Kommunikation<br />
im Hinblick auf gegenseitigen Austausch und<br />
die Vermittlung von Wissen hervor (Thomas Hobbes:<br />
Lehre vom Menschen, Kap. X, Von der Sprache und<br />
den Wissen schaften).<br />
Die Frage des Zusammenhangs von Ding und Wort<br />
spielt auch in der Sprachreflexion des Empi risten John<br />
Locke eine zentrale Rolle. Sprache ist in seinem Sinne<br />
im „geselligen“ Menschen anthropologisch verankert<br />
und bildet „das gemeinsame Band der Gesellschaft“<br />
(John Locke: Versuch über den menschlichen Verstand,<br />
Kap. III, §1). Nach Locke stehen Wörter als Zeichen<br />
für Ideen und Ideen als Zeichen für Dinge. Als Kommunikationsmittel<br />
ist die Sprache dem Men schen<br />
notwendig, um „ideas“ anderen verständlich zu<br />
machen. Vor stellungen (insbesondere „complex<br />
ideas“) sind nicht bei allen Menschen gleich, nicht<br />
für andere wahrnehmbar und kön nen erst durch das<br />
Medium der Sprache transparent gemacht werden.<br />
Locke nimmt den lebendigen zwischenmenschlichen<br />
Dialog in den Blick, in dem Sprecher und Hörer aktiv<br />
Sprache für Verstehensprozesse einsetzen: „Die Worte<br />
sind die sinnlichen Zeichen der Vorstel lungen dessen,<br />
der sie gebraucht […]. Wenn Men schen miteinander<br />
sprechen, so wollen sie verstanden sein, und der Zweck<br />
des Sprechens ist, durch Laute, als Zeichen, seine Vorstellun<br />
gen dem Hörer bekannt zu machen“ (Locke:<br />
Versuch über den menschlichen Verstand, 3. Buch,<br />
2. Kap. § 2).<br />
Gottfried Wilhelm Leibniz nimmt in seiner Schrift<br />
Neue Abhandlungen über den menschli chen Verstand<br />
Bezug auf Locke in Form eines Dialogs zwischen<br />
Philalethus (Locke) und Theophi los (Leibniz selbst).<br />
Sprach<strong>philosophie</strong> 51