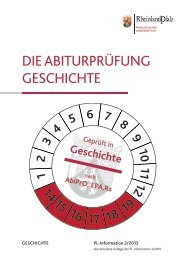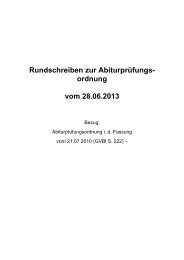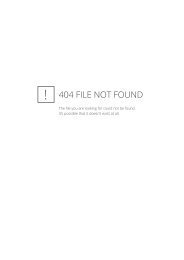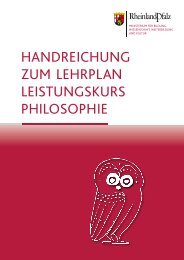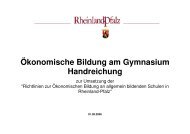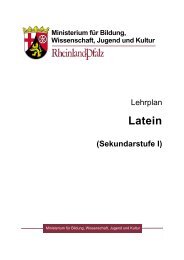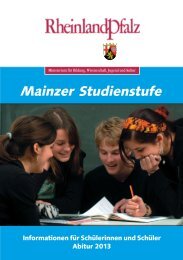handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
nünftigkeit, „sichtbarer Geist“, die ganze Natur ein<br />
zweckmäßig or ganisiertes Kunstwerk, der Geist hingegen<br />
„unsichtbare Natur“ (Friedrich Wilhelm Joseph<br />
Schelling: Ideen zu einer Philosophie der Natur).<br />
Auf Schellings Konzeption des objektiven Idealismus<br />
wird in der Gegenwartsphiloso phie von Vittorio<br />
Hösle (Philosophie der ökologischen Krise) Bezug genommen.<br />
Hösle sieht in der Ich-Philosophie Fichtes<br />
die Zu spitzung einer mit Descartes einsetzenden<br />
Entfremdung des sich absolut setzenden Subjekts<br />
von der Natur; die Hybris dieser auf Herrschaft und<br />
„Weltherrschaft“ ausgehenden Subjektivität habe<br />
zur Konsequenz, dass diese den Eigenwert der Natur<br />
missachte, die Natur <strong>zum</strong> bloßen Objekt degradiere.<br />
Hösle sieht in Schellings Philosophie einen Paradigmen<br />
wechsel, weil Schelling den transzendentalsubjektiven<br />
Ansatz der Philosophie Fichtes, in der<br />
gezeigt werde, wie das Subjekt sich eine Welt entgegensetzt,<br />
durch eine Philosophie der Natur ergänzt,<br />
in der offenbar wird, wie die Natur das Subjekt hervorbringt,<br />
um zur Selbstanschauung ihrer selbst zu<br />
gelangen.<br />
Das optimistische Natur verständnis Schellings bleibt<br />
im Laufe der Ent wicklung seines Denkens allerdings<br />
nicht von Bestand. In der berühmten Freiheitsschrift<br />
von 1809 entdeckt Schelling das Irratio nale und<br />
Abgründige, das dem Wesen der Natur inhäriert.<br />
Gott und Natur partizipieren beide an einem dunklen<br />
Grund, der die Existenz von Gott und Natur<br />
überhaupt erst möglich macht. Nur in der Existenz<br />
Gottes realisiert sich immer schon das Seh nen des<br />
Grundes nach Licht und Geist. In der Natur erkennt<br />
Schelling neben dem Drang nach Selbsttranszendenz<br />
den selbstischen Drang des Grundes, er selbst zu<br />
bleiben. Dieje nige Natur, die in Freiheit sich gegen<br />
den ewigen Geist entscheiden kann, ist der Mensch.<br />
Im Menschen, der alleine zwischen Gut und Böse<br />
wählen kann, „ist die ganze Macht des finsteren Prinzips<br />
und in eben demselben zugleich die ganze Kraft<br />
des Lichts. In ihm ist der tiefste Abgrund und der höchste<br />
Himmel“ (Schelling: Über das Wesen der menschlichen<br />
Freiheit).<br />
Gegenstand von Hegels Phänomenologie des Geistes<br />
ist die „Darstellung des erschei nenden Wissens“, dessen<br />
Selbstbewegung durch die „Reihe seiner Gestaltungen“<br />
aus der Perspektive des philosophischen Bewusstseins<br />
gleichsam zugesehen wird. Den ge samten Prozess<br />
der Selbstbewegung des erscheinenden Wissens ist<br />
für das erschei nende Wissen einerseits ein „negativer<br />
Weg“, weil das natürliche Bewusstsein auf die sem<br />
Wege seine Wahrheit „verliert“, andererseits beinhaltet<br />
dieser Prozess die Selbst findung und „Läuterung“<br />
des natürlichen Be wusstseins und stellt somit<br />
„die Geschichte der Bildung des Bewusstseins zur<br />
Wissenschaft“ dar (Georg Wilhelm Friedrich Hegel:<br />
Einleitung in die Phänomenologie des Geistes). Der<br />
Bil dungsprozess des natürlichen Bewusstseins <strong>zum</strong><br />
Geiste entfaltet sich dabei nicht zufällig, son dern<br />
folgt einer dialekti schen Logik, die das philosophische<br />
Bewusstsein also nicht von außen an seinen Ge genstand<br />
heranträgt, sondern diesem inhärent ist. Alle<br />
möglichen Relationen des Be wusstseins zu seinem<br />
Objekt werden in der Geschichte des erscheinenden<br />
Wissens dabei rekonstruiert. Methodisch ist die Phänomenologie<br />
ein durchgeführter „Skeptizis mus“, weil<br />
das natürliche Bewusstsein an seiner Setzung von<br />
Wahrheit zweifelt, ihre Wi dersprüchlichkeit ent deckt<br />
und deshalb aufhebt. Die Erfahrung, die das Bewusstsein<br />
mit seinen Gestaltungen macht, vollzieht sich,<br />
wie Hegel in der Einleitung ausführt, in zwei Schritten:<br />
der Setzung eines „Ansich“ und der Reflexion des<br />
Bewusstseins über das „Ansich“, das dadurch für das<br />
Bewusstsein wird, als Schein durchschaut und aufgeho<br />
ben wird. Die Erfahrung, die das Bewusstsein mit<br />
sich macht, ist aus der Perspektive des philosophischen<br />
Bewusstseins nichts anderes als das Zu-sichselbst-Kommen<br />
des absoluten Geistes, der nur in<br />
seinem „Anderssein“ zu sich selbst finden kann. Es<br />
ent spricht dabei dem Wesensgesetz des erscheinenden<br />
Wissens, sich zu entäußern, sich zu vergegenständlichen,<br />
um sich im „Anderssein“ als das zu begreifen,<br />
was das Wissen an sich selbst immer schon<br />
ist. Eine leere, ganz für sich seiende Subjektivität,<br />
ein „Ich bin Ich“, widerspricht genauso dem Wesen<br />
des Wissens wie ein Sich-Verlieren des Wissens im<br />
Gegen ständlichen. Zwei Zäsuren kommt innerhalb<br />
der Erfahrungsgeschichte des Wissens besondere<br />
Bedeutung zu: der Überwindung der Tendenz des<br />
Wissens, sich im Anderen, im Gegenständli chen zu<br />
verlieren, indem sich das Wissen als (intersubjektives)<br />
Selbstbewusstsein versteht, und der Geistwerdung<br />
des Wissens, die da eintritt, wo die „Vernunft“ die<br />
Gewissheit hat, „alle Realität zu sein“. Alle Gestalten<br />
des Bewusstseins vor der Geist werdung sind „Abstraktionen“,<br />
erst als Geist wird das erscheinende Wissen<br />
konkret. Die Sphäre des Geistes sieht Hegel zunächst<br />
64<br />
Metaphysik